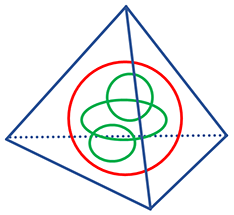Unser Abbild
Ordnung und Chaos
In unserem wissenschaftlichen Weltbild ist alles schön geordnet und unterliegt Gesetzmäßigkeiten. Für ein chaotisches Geschehen ist dort kein Platz. Wir schätzen Ordnung viel höher ein als Unordnung. Und zwar aus praktischen Gründen. Wenn wir eine Ordnung haben, dann finden wir Gegenstände oder Ereignisse leichter wieder, als wenn wir keine Ordnung hätten. Ordnung erleichtert unser Leben. Aber woher kommt die Ordnung? Gründet sie sich auf der Ordnung der Natur? Frühere Kulturen haben das vermutet und eine göttliche oder natürliche Ordnung unterstellt. Heute haben wir von dieser Vorstellung Abstand genommen. Wir schreiben unserer Umgebung heute keine Strukturen oder Informationen mehr zu, sondern akzeptieren unsere Umwelt so, wie sie ist. Es ist nicht die Umwelt, sondern der Mensch, der nach seinen Interessen einigen Teilen der Umwelt eine Struktur und damit einen Sinn gibt. Der Mensch schafft damit Informationen. Die Umwelt ist nur insofern informativ, als wir sie in einer bestimmten Art interpretieren.
Somit sind wir letztlich selbst die ordnende Hand. Wir erfinden die Ordnungen. Und je nach unterschiedlicher Interessenlage erfinden wir auch unterschiedliche Ordnungen. Wer das nicht glaubt, sollte seinen Schreibtisch einmal von einer anderen Person aufräumen lassen. Welche Eltern sind nicht daran verzweifelt, das Ordnungsprinzip im Kinderzimmer nachzuvollziehen. Was für den einen unordentlich aussieht, kann für den anderen durchaus ordentlich sein. Dasjenige, was dem einen als Unordnung vorkommt, erscheint dem anderen möglicherweise als wohlgeordnet.
Diesen Gedankengang wollen wir vertiefen, indem wir uns mit bekannten Beispielen von Heinz von Foerster beschäftigen. Von Foerster fragte: Was ist Ordnung? Wann sagen wir, dass etwas geordnet ist? Betrachten wir dazu die Zahlenfolgen: „2,4,6,8,10“ oder „1,4,9,16,25,36,49“, in denen wir sehr leicht erkennen, nach welcher Regel die Reihen aufgestellt wurden. Dadurch, dass wir eine Gesetzmäßigkeit hinter der Zahlenreihe erkennen, halten wir sie für geordnet. Doch betrachten wir nun die Zahlenfolge: „1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9“. Welche Ordnung verbirgt sich hier? Auf den ersten und zweiten Blick erkennen wir keine Ordnung. Wenn wir aber eine „3“ davor schreiben, dann wird deutlich, dass es sich um die Zahl π (3,141592653589) handelt. Sie ist eine irrationale Zahl, d.h. dass es hinter dem Komma niemals zu einer ständigen Wiederholung kommt. Auch diese Zahlenfolge ist streng regelhaft und jede Folgezahl lässt sich nach einem Algorithmus exakt berechnen.
Die Tatsache, dass wir in den Daten keine Regel erkennen, so dass sie uns als zufällig erscheinen, bedeutet also nicht, dass sie tatsächlich ungeordnet sind. Solange wir die Gesetzmäßigkeit, die dahinter liegt, noch nicht erkannt haben, besteht immer noch die Chance, dass wir die Regel doch noch erkennen werden. Ein weiteres Beispiel von Heinz von Foerster: Betrachten wir die Reihenfolge: „8,3,1,5,9,6,7,4,2“. Was ist hier das Ordnungsprinzip? Es ist das Alphabet. Die Zahlen sind alphabetisch angeordnet – acht, drei, eins, fünf, usw. Selbst verworrene Ansammlungen von Objekten sind potentiell strukturierbar. Wir müssen nur das Prinzip der Regelmäßigkeit finden. Ordnung ist immer eine Eigenschaft des Beobachters und nicht der Dinge. Und jemand, der von etwas sagt, dass es ihm chaotisch erscheint, hat möglicherweise nur die dazugehörige Regel noch nicht gefunden.
Ordnungsprinzipien betreffen aber nicht nur Zahlenkolonnen. Wir sehen häufig etwas, erkennen aber nicht, wie es funktioniert bzw. was es ist. Wenn wir nicht die Theorie oder Regeln verstehen, die die Abläufe regieren, dann sehen wir zwar etwas, erkennen es aber nicht. Das sind keine Spitzfindigkeiten, sondern das ist ganz elementar. „Erkenne, was Du siehst!“ ist äußerst wichtig. Wie werden wohl die Antworten ausfallen, wenn wir zwanzig beliebige Personen unter die Motorhaube eines Lastwagens blicken lassen und sie fragen, was sie dort sehen und erkennen? Einige werden tatsächlich erkennen, was sie sehen. Die meisten werden aber nur sehen und nicht genau wissen, was sie dort sehen. Sie werden kaum etwas erkennen.
Dieses wichtige Prinzip gilt nicht nur für Laien, sondern auch für Fachleute. Wir haben in der Schule gelernt, dass bei allen Säugetieren das Blut im Kreis fließt. Wir verdanken unser Leben unserem Herzen, das ca. 8000 l pro Tag durch ein 96.000 km langes Gefäßsystem pumpt. Das sind nach 80 Jahren ca. 233.600.000 Liter Blut. Man sollte erwarten, dass die Ärzte der Antike und des Mittelalters hätten wissen müssen, wie das Herz-Kreislaufsystem funktioniert. Obwohl über Jahrhunderte immer wieder anatomische Studien an Verstorbenen vorgenommen wurden – bevorzugt an Verbrechern – und obwohl täglich Rinder, Schweine und Schafe geschlachtet wurden, erkannten weder die Ärzte noch die anderen Menschen, was sie dort sahen.
Wir erkennen erst etwas, wenn wir eine Theorie haben, wie es funktionieren könnte. Haben wir die falsche Theorie, dann sehen wir vielleicht Dinge, die es nicht gibt. Der Arzt Galen war sicherlich einer der bedeutendsten Ärzte der Antike und sein anatomisches Verständnis war prägend über 1500 Jahre. Er kannte damals bereits den Unterschied zwischen dunklem, venösem und hellem, arteriellen Blut. Das dunkle Blut wird seiner Meinung nach in der Leber gebildet und sorgt für die erforderliche Energie. Es strömt zum rechten Herzen und fließt durch Poren in das linke Herz. Dort wird dann das helle Blut durch hinzuströmende Luft gebildet, was für die Vitalität sorgt. Das Blut strömt aber nicht zurück, sondern wird in den Organen verbraucht. Galens Modell setzt zwingend voraus, dass es Poren im Herzen gibt. Diese wurden aber nie nachgewiesen. Bei allen Sektionen der nachfolgenden Jahrhunderte wurden die fehlenden Fakten ignoriert und Galens Autorität bedingungslos geglaubt. Niemand brachte über 1500 Jahre den Mut auf, Galen zu widersprechen. Es war der Arzt und Anatom Andreas Vesalius, der die Fakten sprechen ließ. Er veröffentlichte seine Erkenntnisse 1543 in dem fundamentalen Werk „De humani corporis fabrica“. Der Erfolg war ihm sicher, weil er nicht einfach eine neue Lehre verkündete, sondern nur sagte: „Seht tatsächlich hin! Macht Euch Euer eigenes Bild!“ Und nachdem die Poren nicht nachweisbar waren, begannen die Menschen nach anderen Theorien zu suchen. Erst 1628 beschrieb William Harvey dann den Blutkreislauf so, wie wir ihn heute verstehen.
26.2 Individuum ineffabile est
Jetzt wollen wir nicht unsere Lateinkenntnisse testen, sondern wir wollen uns einen äußerst wichtigen Gedankengang nahebringen. Die lateinische Überschrift ist nur dazu gedacht, Aufmerksamkeit zu erregen, damit sich hier alle besonders konzentrieren. Die Übersetzung der Überschrift lautet sinngemäß: „das Individuum ist nicht zu fassen.“ Was ist damit gemeint? Wir wollen das Problem an einer einfachen Situation schildern.
Wir sitzen an einem frühen Abend in unserem Auto auf dem Weg nach Hause. An einer roten Ampel wartend blicken wir zum Beifahrersitz, auf dem ein Strauß mit 15 roten langstieligen Rosen liegt, den wir vor einigen Minuten gekauft haben. Er ist ein Geschenk zum Hochzeitstag. Während wir so auf den Strauß blicken, stellen wir bei den herrlich duftenden Rosen kleine Unterschiede in den Blütenblättern fest. Einige Blüten sind auch mehr geschlossen als andere. Unterdessen wir gemütlich weiterfahren, denken wir darüber nach, wie wir jede einzelne Rose so detailliert beschreiben können, dass sie sich von allen anderen Rosen unterscheidet. Erst durch diese umfassende und einmalige Beschreibung würden wir die Rose als etwas wirklich Einzelnes, als etwas Einmaliges denken können und nicht nur als ein Exemplar aus dem Rosenstrauß. Unsere Gedanken tragen uns schnell weiter zu der Frage, wie wir ein menschliches Individuum in allen seinen Facetten beschreiben müssten, um seiner Einmaligkeit gerecht zu werden. Da es bei einer Person sehr viel schwieriger sein dürfte als bei einer Rose, wenden wir uns wieder der Rose zu und versuchen erst einmal hier eine vollständige Beschreibung. Was müsste alles dazu gehören? Die Farbe und Größe reichen sicherlich nicht aus. Wir müssten nicht nur die Anzahl der Blütenblätter zählen, sondern jedes einzelne Blütenblatt bis ins Kleinste vermessen und nach allen Charakteristika bestimmen – wahrscheinlich bis auf die molekulare Ebene. Dasselbe wäre sicherlich für den Stiel, die Blätter und Dornen erforderlich. Damit hätten wir das Einmalige dieser Rose aber bei weitem noch nicht erfasst. Zur Einmaligkeit der Rose gehört sicherlich auch ihre gesamte Geschichte. Wo ist sie gewachsen? Wer hat sie abgetrennt und wohin transportiert, damit wir sie im Blumenladen auswählen konnten? Wohin wird sie jetzt gebracht? Welche Vase wird für die Rosen ausgewählt und in welchem Arrangement werden die Rosen in die Vase gesteckt?
Die Liste dieser Fragen ließe sich endlos fortsetzen. Da Objekte auch untereinander in Beziehung stehen und diese Beziehungen auch für die Objekte bedeutsam sind, müsste eine umfassende Beschreibung eines einzelnen Objektes unendlich viele Unterbeschreibungen enthalten. Jedes Individuum ist für sich gesehen nicht vollständig beschreibbar. Es ist als Individuum nicht vollständig bis in das letzte Detail zu erfassen. Mit diesem Sinnspruch „individuum ineffabile est“ wird diese Idee ausgedrückt, dass wir ein Individuum bzw. einen einzelnen Gegenstand nicht vollständig umfassend beschreiben können. Wir sind nicht in der Lage, alle Details, die zum Individuum gehören, in angemessener Form auszudrücken. Wir sind gezwungen, uns immer mit einer beschränkten Beschreibung zufrieden zu geben.
Ist dieses Unvermögen, einen Gegenstand nicht vollständig in allen Facetten beschreiben zu können, für uns relevant? Ja und Nein. Es ist für uns insofern wichtig, weil wir in manchen Situationen eine umfangreichere Beschreibung tatsächlich für notwendig erachten. Manchmal erwarten wir einfach mehr Details, als wir von unserem Gesprächspartner erhalten, um uns ein gutes Bild von der Situation zu verschaffen. Wir fordern dann unser Gegenüber auf, den Sachverhalt genauer zu beschreiben. Manchmal sind sehr ausführliche Beschreibungen aber auch nur hinderlich, weil sie die wenigen, wirklich wichtigen Details verdecken. „Individuum ineffabile est“. Wir sind gewohnt und haben gelernt, uns auf diejenigen Eigenschaften zu beschränken, die für uns in der jeweiligen Situation wichtig sind. Wir suchen im Alltag gar keine ausführliche, umfassende Beschreibung. Das wäre für uns viel zu aufwendig. Was wir vielmehr benötigen, sind zwei Beschreibungen. Mit der ersten Beschreibung werden wir in die Lage versetzt, das Objekt zu identifizieren, um das es geht. Die zweite Beschreibung vermittelt uns dann diejenigen Informationen, die wir uns über den Gegenstand wünschen.
Alle Beschreibungen sind interessengeleitet, so dass wir uns je nach unserem situationsabhängigen Interesse andere Informationen über denselben Gegenstand wünschen. Und da die Interessen sich ändern und auch zwischen verschiedenen Personen meistens unterschiedlich sind, sammeln verschiedene Personen andere Informationen über denselben Gegenstand oder dasselbe Ereignis. Das ist keine Schwäche unseres Vorgehens, sondern es schont unsere Ressourcen, indem wir uns nur mit den Informationen beschäftigen, die wir für relevant halten. Wir sollten uns grundsätzlich davor hüten, andere Personen allein deshalb zu verurteilen, weil ihre Informationen oder Beschreibungen unvollständig sind und für unsere eigenen Interessen nicht ausreichen.
26.3 Modelle
Was für Objekte gilt, trifft natürlich auch auf Ereignisse zu. Wir wollen in manchen Studien wissen, welchen Einfluss bestimmte Gifte auf die Umwelt haben, wir wollen den Einfluss von Elektrosmog auf das körperliche Befinden oder die Entstehung von Hirntumoren untersuchen. Uns ist dabei klar, dass wir niemals alle Einflussgrößen berücksichtigen, ja noch nicht einmal beschreiben können. „Individuum ineffabile est.“
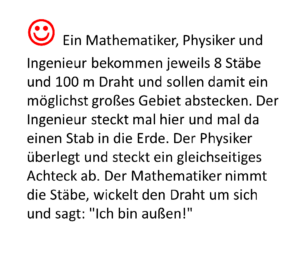
Um Probleme zu lösen und interessante Fragen zu beantworten, stellen wir Modelle auf. Welches Modell wir aufstellen und wie ausgefeilt es ist, hängt vom Problem ab. Die Fragestellung entscheidet darüber, welches Modell wir wählen. Wenn wir das falsche Modell auswählen, dann erhalten wir im günstigsten Fall keine Antwort und im schlechtesten eine falsche. Deshalb ist es so wichtig, ein gutes Modell zu wählen. Ob ein Modell wirklich das Beste für die Fragestellung ist, kann niemals sicher beantwortet werden. Weder die erfolgreiche Durchführung, noch die plausiblen Ergebnisse garantieren, dass das Modell ein gutes Abbild der Realität ist. Gesunde Skepsis ist immer angebracht.
Was zeichnet ein Modell aus? Warum arbeiten wir mit Modellen und nicht mit der Realität als solcher? Weil die Realität viel zu komplex und unübersichtlich ist. „Realitas ineffabilis est“ könnten wir auch sagen. Modelle enthalten nur kleine, überschaubare, ausgewählte Ausschnitte unserer Welt. Es werden nur ganz bestimmte Eigenschaften in diesem reduzierten Ausschnitt der Realität berücksichtigt. Es sind Eigenschaften, die wir kontrollieren und messen können. Wenn wir uns ein Modell ausdenken, dann sollten wir die wichtigsten Zusammenhänge in unserem Modell kennen. Sollten wir uns dabei irren und sollten wir wichtige Einflussgrößen vergessen haben, dann ist das Modell untauglich. Was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass ein „falsches“ Modell nicht zu „richtigen“ Ergebnissen führt. Wir können sogar Glück haben und selbst aus einem ungeeigneten Modell richtige Schlussfolgerungen ziehen. Das ist aber deutlich unwahrscheinlicher, als aus einem korrekten Modell richtige Folgerungen zu ziehen.
Wenn wir eine wissenschaftliche Antwort auf eine Frage suchen, dann entwerfen wir im Idealfall einfache experimentelle Modelle, um bestimmte Annahmen zu überprüfen. Wir reduzieren die möglichen Einflussgrößen auf wenige und modifizieren diese, um den Einfluss der einzelnen Größen einschätzen zu können. Alle anderen möglichen Einflussgrößen, die in unserem komplexen Universum sicherlich vorhanden sind, bleiben unberücksichtigt. Wir könnten auch provozierend sagen, dass die wissenschaftliche Methode auf der Annahme basiert, dass fast alles in unserem Universum irrelevant ist. Diese Annahme ist sicherlich falsch, aber wir sind aufgrund beschränkter Ressourcen gezwungen, unter dieser Annahme zu überleben. Wir haben weder die Zeit noch das Vermögen, alle Einflussgrößen zu berücksichtigen – weder in der Wissenschaft noch im Alltag. Wir sind immer gezwungen, nur einigen wenigen Einflüssen unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Sollten wir wichtige vergessen haben, dann werden wir durch die Realität rasch eines Besseren belehrt, weil dann unsere Vorhersagen nicht stimmen und die praktische Umsetzung theoretischer Annahmen erfolglos bleiben wird.