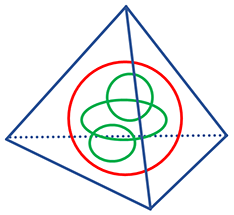Geschichte der Statistik
Wir sollten uns von der Überschrift auf gar keinen Fall nur deshalb abschrecken lassen, weil wir hier den Begriff „Statistik“ verwenden. Es gibt einen gewichtigen didaktischen Grund, warum ein geschichtlicher Rückblick für uns sehr gewinnbringend sein wird. Früher traten nämlich ähnliche Probleme auf wie heute, aber damals verfügte man noch nicht über so komplexe Lösungsstrategien. Man war gezwungen, die Probleme mit relativ einfachen Mitteln zu lösen. Dazu wurden die komplexen Schwierigkeiten in einfachen Strukturen und Modellen abgebildet und diese dann den vorhandenen methodischen Möglichkeiten zugeführt. Die historischen Probleme und Lösungsversuche sind für uns meistens verständlicher und leichter nachvollziehbar. Außerdem wurde bereits damals von den Fachleuten erkannt, welche grundsätzlichen Beschränkungen die verschiedenen Lösungsansätze mit sich bringen, mit denen wir auch heute noch zu kämpfen haben.
Woher stammt überhaupt das Wort „Statistik“? War es schon immer mit unserem gegenwärtigen Verständnis einer mathematischen Statistik verknüpft? Während sich die letzte Frage eindeutig verneinen lässt, liegt ein gewisser Grauschleier über dem Ursprung. „Statistik“ wurde 1672 erstmalig von Heleno Politano erwähnt, was noch gar nicht so lange her ist. Einige Jahre vorher hatte aber bereits Hermann Conring seine Helmstädter Vorlesungen von 1660 als „Collegium politico-statisticum“ angekündigt, so dass wir eher Conring als „Vater“ des Begriffs ansehen können. Nachdem sich der Begriff „Statistik“ etabliert hatte, führte Gottfried Achenwall den Begriff auf „statista“ zurück, was im Italienischen „Staatsmann“ oder „Politiker“ bedeutete. Aus dem lateinischen Adjektiv „statisticus“ wurde die „disciplina politico-statistica“, woraus dann abgekürzt „Statistik“ wurde. Hier ist von Mathematik keine Spur. In Achenwalls „Staatsverfassung“ wird die Statistik als Inbegriff des Wissens eines Staatsmannes verstanden – wie „überhaupt aller Stände, die sich um die heutige große Welt zu bekümmern haben und besonders denen, die als Rechtsgelehrte und Staatsleute ihrem Herrn und Lande dienen wollen, sehr nützlich und in vielen Fällen notwendig ist. Hauptsächlich aber, wer die jetzigen Welthändel gründlich beurteilen, wer seine Reisen in fremde Länder mit Nutzen unternehmen, wer in Regierungs-, Polizei-, Manufaktur-, Handels- und Kameralsachen, oder in Gesandtschaften und Unterhandlungen mit auswärtigen Staaten sich gebrauchen lassen will, dem ist ihre Erlernung unentbehrlich.“ (zitiert nach: John V. Geschichte der Statistik, 1884, S. 11). Achenwall umschreibt hier die sogenannte Universitätsstatistik, die sich kaum mit unserem heutigen Verständnis der Statistik vereinbaren lässt. Wir dürfen aber gespannt sein, wie sich dieses alte Verständnis zur mathematischen Statistik entwickelt hatte.
Die Statistik im oben genannten Sinn bestand rudimentär schon seit Jahrtausenden, denn die herrschende Klasse hatte immer schon versucht, das zugehörige Volk zu zählen und das eigene Herrschaftsgebiet zu vermessen. Der entscheidende Grund war nicht das wohlwollende fürsorgliche Interesse der Machthaber, sondern das Festlegen von Steuern. Kein Herrschaftssystem konnte sich jemals selbst finanzieren. Alle waren auf Steuereinnahmen angewiesen, die nach gerechten oder ungerechten Kriterien erhoben wurden. Um den Geldeintreibenden ein wenig auf die Finger zu schauen, wurde immer wieder versucht, ein rudimentäres Kontroll- und Finanzsystem aufzubauen. In der westlichen Geschichte ist von Karl dem Großen überliefert, dass er damals seine Kammergüter bis ins letzte Detail inventarisieren ließ und fortlaufende Listen der kriegsfähigen Mannschaften führte. Damit konnte er sich eine gewisse Übersicht über sein Reich verschaffen. Später war es Wilhelm der Eroberer, der das englische Reichsgrundbuch (1083–1086) einführte, das auch heute noch im Museum einsehbar ist. In dieser Zeit zogen seine Kommissare durchs Land, vereidigten die lokalen Sheriffs, Pfarrer und Grundeigentümer und erfassten alles, was wertvoll war. Darunter waren alle Ländereien, Holzungen, Wiesen und Äcker, Mühlen, Fischteiche, Zugvieh, Leibeigene und selbst Bienenkörbe. Die Anzahl der Einwohner, die Pachtgebühren und alle Dienstleistungen wurden ebenfalls aufgezeichnet, so dass Wilhelm einen verlässlichen Bericht über seine potentiellen Einkünfte erhielt. Dieses umfangreiche Kataster ist bis heute erhalten geblieben und offenbart die Besitz-, Einkommens- und Dienstverhältnisse jener Tage.
Die Vorteile solcher fundamentalen Übersichten sind so offensichtlich, dass in den darauffolgenden Jahrhunderten nicht nur die Herrschenden, sondern auch einige Forscher damit begannen, solche Statistiken zusammenzustellen und zu pflegen. Allerdings basierten diese Datensammlungen mehr auf individuellen Interessen, denn die akademische Welt nahm kaum Notiz von ihnen. Sie wurden als Sammelwerke einzelner Autoren wie Sansovino, Botero, Guiccardini, Papst Pius II oder d’Avity angesehen, die lediglich von denen studiert wurden, die die Besonderheiten der unterschiedlichen Länder kennenlernen wollten. Alle genannten Autoren waren zwar bestrebt, die verfügbaren politischen Faktoren in einem einheitlichen Bild zusammenzufassen, doch es mangelte an einer klaren und einheitlichen Systematik.
Wir könnten uns fragen, warum solche Informationen überhaupt nötig waren, wenn wir von den Steuereinnahmen absehen? Um diese Frage zu beantworten, stellen wir uns vor, wir wären Kurfürst in einem mitteldeutschen Lande jener Zeit. Wir reisen mit der Kutsche durch unser Land und freuen uns über die schöne fruchtbare Landschaft und die gut ernährte und bestens ausgebildete Bevölkerung. Wir reisen von einer blühenden Stadt zur anderen und kehren dann auf unser prunkvolles Schloss zurück. Eines Tages werden wir von einem befreundeten benachbarten König eingeladen, sein Land zu besuchen. Er zeigt uns voller Stolz seine Ländereien und weist immer wieder darauf hin, dass seine Ländereien viel fruchtbarer seien als unsere, dass er viel größere und reichere Städte auf seinen Ländereien angesiedelt hätte als wir und dass er über viel mehr Bodenschätze verfüge. Wir schlucken höflich unsere Erwiderung herunter und reisen nach einigen Tagen ab. Zu Hause angekommen rufen wir eilends den Staatsrat zusammen und verlangen eine vergleichende Beschreibung beider Länder, um zu überprüfen, ob der königliche Freund nur aufgeschnitten hat oder tatsächlich reicher ist. Nebenbei lassen wir prüfen, ob er über mehr Soldaten verfügt, besser ausgerüstet ist und mit wem er verbündet ist – quasi als Vorsorge:). Die Beamten oder Staatsmänner hätten uns diese Informationen aber kaum liefern können, weil wenige vergleichende Daten zwischen den Staaten existieren, wenn überhaupt. Wir hätten vielfach nur spekulieren können, wer wohl der Reichere und Stärkere ist.
15.1 Universitätsstatistik
Diese vergleichenden Informationen mussten bereitgestellt werden, weil sie zur immer komplexer werdenden Staatsführung erforderlich wurden. Es entwickelte sich die Universitätsstatistik, die Hermann Conring begründete, der 1606 als neuntes Kind eines Predigers in Ostfriesland geboren wurde. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten und Kenntnisse wurde er zum Professor für Philosophie, Medizin und Politikwissenschaft ernannt. Er war vorübergehend Leibarzt der Königin von Schweden und beriet aufgrund seines profunden Wissens viele Könige seiner Zeit. Nachdem er sehr erfolgreich in Helmstedt tätig war, wurde er nach Göttingen berufen, wo er 1660 das Fachgebiet „Staatskunde“ gründete und damit den Grundstein für die Universitätsstatistik legte. Sein Ziel war es, Staatsmänner in den Grundlagen der politischen Geschäfte auszubilden. Dazu sollten sie befähigt werden, systematische und vergleichende Beschreibungen der verschiedenen Staaten richtig zu interpretieren. Conring entwickelte eine sehr komplexe und umfassende Lehre. Er forderte unter anderem, die Bevölkerung nicht nur zu zählen, sondern zusätzlich nach ihrem Status und öffentlich-rechtlichen Beziehungen zu erfassen: Nach Geschlecht, Alter, Beruf und Beschäftigung, Stand, für den Kriegsdienst tauglich, geistig gesund. Er erkannte bereits damals aufgrund seiner einfachen Analysen, dass einige Staaten an Unter- und andere an Überbevölkerung litten. Wegen seiner systematischen Staatsbeschreibungen wird Conring als Vater dieser „Statistik“ angesehen.
Der berühmteste Nachfolger Conrings ist Gottfried Achenwall, der 1719 im preußischen Elbing geboren wurde. 1748 begann er mit seinen Vorlesungen in Göttingen, die er bis zu seinem Tod 1772 fortsetzte. Er propagierte eine Lehre von der Staatsverfassung, die die „wirklichen Staatsmerkwürdigkeiten“ umfassen sollte. „Die in dieser Theorie klar ausgesprochene Aufgabe der Statistik ist, die unerlässlichen und verlässlichen konkreten Unterlagen zu sammeln und in systematischer, übersichtlicher Ordnung darzubieten für ein begründetes staatsmännisches Urteil über den jeweiligen politischen, militärischen, wirtschaftlichen und finanziellen Zustand der einzelnen Staaten der Gegenwart; denn der Hauptnutzen dieser Statistik besteht gerade darin, dass man durch dieselbe in den Stand gesetzt wird, nicht nur über allerlei Staatssachen richtig und gründlich zu urteilen, sondern auch die Geschicklichkeit zu erlangen, sich erforderlichen Falles zu deren Behandlung mit Rat und Tat gebrauchen zu lassen.“ (John V. Geschichte der Statistik, 1884, S. 83).
Wir können heute kaum nachvollziehen, wie man die Fülle des gesammelten Materials zu bewältigen versuchte. Die Beschreibungen aller dieser Sachverhalte mussten zwangsläufig äußerst unübersichtlich werden, zumal die Anforderungen an detaillierte Informationen immer weiter zunahmen. Deshalb begann ein Zeitgenosse Achenwalls mit Namen Auchersen ab 1741 die wichtigsten Daten als Zahlen in Tabellen abzubilden, so dass die Staaten besser vergleichbar wurden. Durch die Tabellenform wurden die Gelehrten gezwungen, sich auf Merkmale zu beschränken, die gezählt werden konnten. Relativ rasch lagen übersichtliche Tabellen der Flächeninhalte der Territorien, der Finanzen, der Armeen und der Maße und Gewichte vor.
Gegen diese Tabellenstatistik wurde mit Leidenschaft argumentiert und Auchersen samt seiner Anhänger wurde als „Tabellenknechte“ beschimpft. Man befürchtete damals, dass man sich mit den Tabellen nur noch auf das Materielle und Abzählbare beschränken und die ideellen Werte eines Landes vergessen würde. Noch 1806 heißt es: „Zu einem hirnlosen Machwerk ist die Statistik geworden einzig durch die Schuld der politischen Arithmetiker. Diese geistlosen Menschen wähnten und verbreiteten den Wahn, dass man die Kräfte eines Staates schon daran kenne, wisse man auch nur die Zahl der Quadratmeilen des Landes, seine Volksmenge, seine (relative) Bevölkerung, der Nation Einkommen und das liebe Vieh dazu. Die ganze Wissenschaft der Statistik, einer der edelsten, ist durch die politischen Arithmetiker um alles Leben, um allen Geist gebracht und zu einem Skelett, zu einem wahren Kadaver herabgewürdigt, auf das man nicht ohne Widerwillen blicken kann.“( John V. Geschichte der Statistik, 1884, S.129). Die Tabellenstatistiker konterten: „Sie könnten das von unwissenden Laien ebenso frech als widersinnig erhobene, und von seichten und bequemen Statistikern unterstützte Geschrei nicht anders als mit Verachtung anhören; jenes Geschrei, wodurch man die Welt glauben machen wolle, als sei durch die Untersuchungen über Größe und Volkszahl der europäischen Staaten unsere ganze statistische Literatur verdorben, unsägliches Unglück für unsere Länder gestiftet und Jammer und Elend über ganz Europa verbreitet.“ (John V. Geschichte der Statistik, 1884, S. 130f).
Achenwalls Anspruch war mit puren Zahlentabellen nicht erfüllbar: „Die Statistik hebt hervor, was die Vorzüge und Mängel eines Landes anzeigt; die Stärke oder Schwäche eines Staates ausmacht; den Glanz der Krone verherrlicht oder verdunkelt, den Untertan reich oder arm, vergnügt oder missvergnügt, die Regierung beliebt oder verhasst, das Ansehen der Majestät in und außer Landes furchtbar oder verächtlich macht; was einen Staat in die Höhe bringt, den andern erschüttert, den dritten zu Grunde richtet; einem die Dauer, dem andern den Untergang prophezeit – kurz alles, was zur gründlichen Einsicht des Reiches und zur vorteilhaften Anwendung im Dienste des Landesherrn etwas beitragen kann.“ (John V. Geschichte der Statistik, 1884, S. 133).
Die Universitätsstatistik erhob einen ganzheitlichen Anspruch. Sie wollte einen Staat als etwas Ganzes verstehen, als eine harmonische Verknüpfung der Bevölkerung mit bestimmten Sitten und Bräuchen, einem politischen System, einer Wirtschaftsform, wechselnder Vegetation, Bodenschätzen, Klimabedingungen usw. Erst alle diese Faktoren gemeinsam repräsentieren den Staat. Wenn wir diesen Anspruch stellen, alle wichtigen Merkmale zu erfassen, dann stoßen wir rasch auf eine unübersehbare Beschreibungsvielfalt. „Individuum ineffabile est.“ Wenn wir jetzt auch noch einzelne Gruppen oder Personen beschreiben wollten, wären wir in der Datenflut hilflos versunken. In der Medizin herrscht bis heute ein ähnlicher „Streit“ zwischen einer ganzheitlichen Personenbetrachtung und der Reduktion auf bestimmte Untersuchungsergebnisse.
Auch wenn sich dieser ganzheitliche Anspruch auf den ersten Blick gut anhört und viele Befürworter finden wird, egal ob es sich um einen Staat oder um eine Person handelt, ist er nicht einlösbar. „Individuum ineffabile est“. Wir können einen Staat oder eine Person nicht vollständig erfassen. Wir sind immer gezwungen, uns auf bestimmte Merkmale zu beschränken. Um in der Flut von beliebigen Merkmalen nicht zu ertrinken, wählen wir nur sehr wichtige Eigenschaften aus. Wir beschränken uns auf dasjenige, was uns interessiert. Diese Auswahl ist interessengeleitet und daher subjektiv. Der eine wird einen Staat mehr nach seiner kulturellen Leistung beurteilen und der andere nach seiner ökonomischen. Ein Arzt, der einen Patienten psychotherapeutisch behandelt, wird sich mehr für die differenzierten Befindlichkeiten und subjektiven Störungen interessieren, als ein Chirurg, der einen bösartigen Tumor operieren soll. Die interessengeleitete Auswahl bestimmter Merkmale ist solange unproblematisch, solange wir unterschiedliche Interessen offenlegen, zugeben und tolerieren.

Tab. 15-1 Eigenschaften verschiedener Staaten
Wenn wir uns auf einige qualitative Merkmale konzentrieren, dann können wir zum Beispiel die Staaten oder Städte miteinander vergleichen. Dazu könnten wir ihre Eigenschaften tabellarisch aufschreiben und über Kreuz vergleichen. Wir schreiben in die Zeilen die Staaten und in die Spalten die Eigenschaften. In den einzelnen Feldern beschreiben wir dann die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Staaten. Richtig vergleichbar werden die Staaten oder Städte aber dadurch noch nicht. Wir müssen nämlich vorher klare Kriterien festgelegt haben, wie wir die Daten sammeln und zusammenfassen, damit sie wirklich vergleichbar werden. Dieses Vorgehen führt konsequenterweise dazu, dass die Staaten und Städte auf einfache Merkmale reduziert werden. Sie werden damit ihrer typischen und liebenswerten Eigenheiten beraubt, denn selbst die wenigen ausgewählten Merkmale, für die wir uns entscheiden, müssen die vorher definierten Kriterien erfüllen, damit wir die Eigenschaften richtig einordnen können. Wenn zum Beispiel eine Bevölkerung bestimmte Bräuche aufweist, die die anderen überhaupt nicht haben, können wir sie nicht miteinander vergleichen. Wir stülpen letztlich allen Staaten ein gemeinsames Raster über, durch das die Vergleichbarkeit entsteht. Wir erkaufen Vergleichbarkeit, indem wir die Besonderheiten weglassen. Wir reduzieren Individualität und erzeugen Gleichförmigkeit.
Je mehr Individualität wir zulassen, umso weniger können wir die Staaten oder Personen miteinander vergleichen. Wir könnten darauf bestehen, sie umfassender zu beschreiben, aber dann wird ein Vergleich misslingen. Wollen wir aber ernsthaft etwas vergleichen, dann müssen wir fairerweise auf alle Beteiligten dieselben Kriterien anwenden, denn sonst würden wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Um faire Vergleiche zu garantieren, müssen die Kriterien so ausgewählt werden, dass sie auf alle gleichermaßen anwendbar sind. Beides, ein hohes Maß an Individualität und ein hohes Maß an Vergleichbarkeit, ist nicht zugleich zu realisieren. Je mehr wir von dem Einen wollen, umso mehr müssen wir vom Anderen preisgeben. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist nicht möglich.
Wer darüber hinaus nicht nur vergleichende Betrachtungen anstellen möchte, sondern beim Vergleichen auch noch Zählen und Berechnen will, der ist gezwungen, noch weiter zu vereinfachen. Zahlen sind besonders gut geeignet, um sie in übersichtlichen Tabellen anzuordnen. Wenn wir diesen Weg gehen, dann finden wir statt den Besonderheiten einer Bevölkerungsgruppe, ihren Vorzügen und Nachteilen, am Ende nur noch ihre Anzahl in der Tabelle wieder. Personen mit ihren komplexen Eigenschaften werden auf diese Weise auf eine Zahl geschrumpft. Wer tatsächlich die massenhaften Informationen überblicken will, der muss sie in Zahlen ausdrücken und in Tabellen ordnen. Wer komplexe Sachverhalte nicht auf einfache Zahlen reduziert, wird zu keiner Übersicht gelangen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir uns an der Vielfalt eines Regenwaldes ergötzen möchten und nicht wissen wo wir uns befinden, oder ob wir uns über den Regenwald erheben, um eine Übersicht zu gewinnen. Beides zugleich ist nicht möglich.
Die Tabellenform hatte sich zwangsläufig durchgesetzt, weil sie für eine vergleichende Methode unabkömmlich ist. Wir haben uns heute an die Quantifizierung von Merkmalen so gewöhnt, dass wir einer rein qualitativen Beschreibung die Wissenschaftlichkeit absprechen würden. Wir heben uns die blumigen qualitativen Beschreibungen eher fürs Erzählen auf. Bemerkenswerte Besonderheiten gehören in Anekdoten und nicht in wissenschaftliche Berichte. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt ging etwas verloren, was wir gelegentlich vermissen. Wir sind gewohnt, nur noch diejenigen Sachverhalte wissenschaftlich ernst und damit als existierend anzusehen, die wir messen und in Zahlen ausdrücken können. Indem wir aber die Eigenschaften eines Gegenstandes oder eines Ereignisses auf das bloß Messbare reduzieren, verzichten wir auf Qualitäten, die für uns sehr wichtig sein könnten. Die klassischen Statistiker sahen die Wahrheit im Detail, im Einzelnen, in bestimmten Eigenheiten. Sie wollten diese individuellen Komponenten nicht aufgeben, weil sie intuitiv wussten, wie wichtig sie für unser Lebensgefühl sind. Wer sich am Duft einer Blume berauscht, wer die Architektur einer Kathedrale bewundert oder einer Sinfonie verzückt lauscht, der kann sich nicht mit einfachen Zahlen zufrieden geben.
Heute ist es völlig anders. Wir sprechen nicht über einzelne Individuen sondern über Durchschnittsmenschen, Normalverteilung und Populationen. Den Blick fürs Besondere haben wir uns in der Wissenschaft abgewöhnt, denn wir beschäftigen uns mit dem Allgemeinen, mit Regeln. Das Besondere bewahren wir uns für Literatur, Kunst und Musik auf. Da wir aber auf qualitative Eigenheiten nicht ganz verzichten wollen, wenden wir seit Jahrzehnten einen Trick an, um uns auch diese besonderen Details nicht entgehen zu lassen: Wir entwickelten subjektive Bewertungs-Scores. So beurteilen wir einen Wein oder Käse, Schmerz oder Lebensqualität mit Scores bzw. Punkten und können damit wieder etwas vergleichen. Ob wir damit erfolgreich sind, erscheint fraglich. Wenn zwei Weine von Parker getestet wurden und beide 93 Punkte erhalten haben, dann schmecken sie nicht einmal ähnlich. Wir können höchstens zugestehen, dass sie hervorragend sind. Wenn der Schmerzscore von zwei Patienten mit 3,2 Punkten (von maximal zehn Punkten) angegeben wurde, dann reicht ein Blick in die Augen des Patienten, um leicht zu erkennen, dass einer von ihnen sehr viel mehr Schmerzen verspürt als der andere. Heute quantifizieren wir letztlich alles, was uns irgendwie interessiert, um es in das Korsett des Messens zu zwängen. Vor Jahrhunderten war allen Beteiligten der Verlust dieser Qualitäten gegenwärtig und deshalb haben sie sich dagegen gewehrt – erfolglos.
15.2 Politische Arithmetik
Schwenken wir von Deutschland nach England, wo sich parallel zur Universitätsstatistik eine ganz andere Art der Statistik entwickelte, die als „politische Arithmetik“ bekannt wurde. Der entscheidende Anstoß kam 1662 von John Graunt, der die Geburten- und Sterbelisten der Stadt London auswertete und seine relativ überraschenden Ergebnisse der Royal Society mitteilte. Graunt suchte nicht nach systematischen Konzepten wie die Universitätsstatistik, sondern er analysierte lediglich die verfügbaren Jahresrechnungen, die von den Pfarrern seit 1603 zusammengestellt worden waren. Die Pfarrer waren verpflichtet, alle Verstorbenen und Getauften zu erfassen, in den Gottesdiensten zu verkünden und in Listen niederzuschreiben. Aus diesen einfachen Daten konnte Graunt schlüssig und reproduzierbar nachweisen, dass das Verhältnis zwischen Mädchen und Knaben bei 14:13 lag, dass insgesamt mehr Menschen starben als getauft wurden, und dass die Lücken, die die Pest in der Bevölkerung hinterlassen hatte, innerhalb von zwei Jahren wieder aufgefüllt waren. Graunt konnte viele interessante Details belegen, die allerdings mit einer gewissen Unsicherheit behaftet blieben, weil ungefähr 30 Prozent der Neugeborenen nicht getauft wurden und die Qualität der Sterbelisten von der Qualität der Leichenbeschauer abhing, die meistens keine Ärzte, sondern speziell ausgebildete „Weiber“ waren. Dennoch waren die abgeleiteten Informationen so überwältigend, dass viele andere Wissenschaftler dem Vorbild Graunts folgten. Nachdem auch die Listen anderer Städte ausgewertet wurden, waren die Ergebnisse überraschenderweise in vielen Städten sehr ähnlich, was der „politischen Arithmetik“ weiteren Auftrieb verlieh.
Die Methode, die Graunt verwendete, war strikt unakademisch, worauf er auch in seiner Schrift hinwies. Er sagte von sich, dass er nichts anderes getan hätte, als das, was eine einfache Krämerseele vermochte: Zählen. Er sammelte die Daten von 229.250 Toten, die innerhalb von zwanzig Jahren gestorben waren, und gewann mit ihnen wichtige Einblicke in die Dynamik der Bevölkerung. Er ordnete seine Ergebnisse in übersichtlichen Tabellen an, so dass jeder seine Folgerungen nachvollziehen konnte. Sein Nachfolger William Petty setzte die Forschung über die Bevölkerung fort und führte den Begriff „Politische Arithmetik“ ein. Er dehnte das Messen und Zählen auf alles aus, was er für bedeutsam hielt, und er glaubte, damit nachweisen zu können, dass selbst ein kleines Land wie England aufgrund seiner geographischen Lage, seines Handels und seiner Politik, mit den größeren Mächten mithalten könne, die über mehr Land und eine größere Bevölkerung verfügten.
Eine weitere Verbesserung führte der bekannte Astronom und Mathematiker Edmond Halley ein, der die Geburts- und Todeslisten der Stadt Breslau von 1687 bis 1691 auswertete und dabei zusätzlich das Alter und Geschlecht der Verstorbenen berücksichtigte. Da die Bevölkerung Breslaus im Vergleich zu London stabiler war, versprach Halley sich eine größere Genauigkeit und Sicherheit seiner Analysen. Er notierte seine Ergebnisse in etwas ungewöhnlichen Tabellen, weil noch keine geeigneten mathematischen Modelle existierten, um die Lebenswahrscheinlichkeit zu berechnen.
Die Methode der politischen Arithmetik wurde als revolutionär empfunden, weil bis dahin unterstellt wurde, dass die Geburten- und Sterberate als „göttliche“ Fügung aufzufassen waren, die sich einer systematischen Betrachtung oder gar Beeinflussung entzogen. Es kam den Menschen bis dahin gar nicht in den Sinn, dass sie gezielt modifiziert werden könnten, indem zum Beispiel die Bildung und Gesundheit verbessert werden. Je mehr Daten verfügbar wurden, umso mehr offenbarten die Analysen eine gewisse Ordnung und Abhängigkeit. Besonders das Versicherungswesen und der Leibrentenkauf interessierten sich sehr stark für diese Regelmäßigkeiten, denn man suchte nach verlässlichen Sterbetafeln, nach denen man die Prämien berechnen konnte. Der Holländer Willem Kerseboom, der die Bevölkerung Amsterdams untersuchte, entwickelte die gesamte Auswertung mathematisch weiter und entdeckte dabei, dass das Zufällige, das Besondere, in der Beobachtung großer Massen völlig verschwindet.
Der Feldprediger Johann Peter Süssmilch war von den Ergebnissen der politischen Arithmetik so fasziniert, dass er dahinter eine göttliche Ordnung vermutete. Als Feldprediger, der vorher Medizin, Jura und Theologie studiert hatte, veröffentlichte er 1741 sein Werk „Die Göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen.“ In dieser Schrift beschrieb er nicht nur den aktuellen Stand der Bevölkerungsstatistik, sondern er erkannte ganz klar, dass alle zufälligen, lokalen Variationen und Besonderheiten aus den gesammelten Daten verschwinden, wenn man eine hinreichend große Zahl analysierte. Er sah bei hinreichend vielen Beobachtungsdaten überall die gleichen Regeln und die gleiche Ordnung, die er als indirekten Beleg für die Existenz Gottes ansah.
Aus den zunehmend verfügbaren Daten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerungsstatistik entwickelte der Nationalökonom Thomas Robert Malthus unter anderem seine komplexe Bevölkerungstheorie und spätere politische Ökonomie. Seine Vorschläge zur Überwindung der sich anbahnenden Überbevölkerung beeinflussten fast alle Wissenschaften und manche sehen Malthus als Vater der Sozialstatistik. Malthus „zeigt zum ersten Male die menschliche Gesellschaft als ein Ganzes, bestimmt durch die ökonomischen Zustände.“ (John V. Geschichte der Statistik, 1884, S. 308). Malthus steht am Ende einer englischen Entwicklung, in der die empirisch gewonnenen Daten systematisch gesammelt, ausgewertet und interpretiert wurden.
15.3 Der Durchschnittsmensch
Die damalige Auswertung war aus heutiger Sicht noch rudimentär, weil das mathematische Instrumentarium noch nicht verfügbar war. Es waren der geniale Mathematiker Pierre Simon de Laplace, der die Wahrscheinlichkeitsrechnung systematisch entwickelte, und sein Nachfolger Joseph Fourier, der sie konsequent auf die Bevölkerungsstatistik anwandte. Beide bereiteten die entscheidenden Schritte des Belgiers Lambert Adolf Jakob Quetelet vor, der als Begründer der modernen Statistik gilt, weil er Daten nicht nur sammelte, sondern sie auch mathematisch auswertete. Dabei stieß er überraschenderweise immer wieder auf normalverteilte Daten (s. Kap. 7-3), die einer mathematischen Aufarbeitung besonders zugänglich waren. In seinen Hauptwerken konzentrierte er sich auf die Sozialstatistik und Anthropologie. Sehr umstritten war seine Moralstatistik, in der er glaubte, nachgewiesen zu haben, dass in vergleichbaren sozialen Gruppierungen die Verbrechen gleich häufig auftreten. Egal, wie man den einzelnen Mord als vielleicht zufälliges Ereignis wertet und eine individuelle Kausalkette und Motive sucht, aus der Sicht des Statistikers werden innerhalb einer sozialen Gruppe immer eine bestimmte Rate an Morden verübt. „Diese Konstanz der jährlichen Verbrechen und der Ordnung ihrer Wiederkehr in nahezu gleichem Verhältnis … bewegt Quetelet zu dem Ausruf: „Es gibt ein Budget der Gefängnisse, der Galeeren und des Schafotts, welches wir jährlich mit einer größeren Regelmäßigkeit entrichten, als jenes der Finanzen. … Die Gesellschaft schließt die Keime der Verbrechen in sich. Jeder soziale Zustand hat eine bestimmte Zahl und Ordnung von Delikten zur Folge; dieselben erscheinen als die notwendige Konsequenz seiner Organisation“ (John V. Geschichte der Statistik, 1884, S. 347f). Quetelet belegte, dass die Verbrechen abhängig vom Alter, Geschlecht, Klima, Rasse und Armut waren. Die ärmsten Bereiche zeigten überraschenderweise die höchste Sittlichkeit, während die wohlhabendsten Bereiche die höchsten Verbrechensziffern aufwiesen. Quetelets statistische Sichtweise mündete in dem Konzept eines Durchschnittsmenschen, einem Idealtyp des mittleren Menschen, der zwar physisch nicht existiert, weil er eine abstrakte Größe ist, dessen Eigenschaften sich aber als Durchschnitt angeben lassen. Alle realen Menschen sind quasi nur Varianten dieses Durchschnittsmenschen und sie oszillieren um diesen Durchschnitt herum.
Quetelets Ideen sind die indirekte Folge der Französischen Revolution. Nach der Revolution wurde in der westlichen Welt eine zunehmende Vereinheitlichung angestrebt. Man wollte die Sprachenvielfalt vermindern, man führte einheitliche Maße und Gewichte ein, man schaffte ein einheitliches bürgerliches Recht, man verabschiedete sich von den Privilegien einiger Stände und man entwickelte einheitliche Verwaltungsstrukturen. Alle diese Maßnahmen waren von dem Ziel geprägt, einheitliche Maßstäbe zu setzen, damit unsere Entscheidungen und darauf aufbauende Handlungen wiederholbar, übertragbar und vorhersagbar werden können. Im immer komplexer werdenden Zusammenleben wurden von den Individuen zunehmend Sicherheit und Verlässlichkeit gefordert. Um sich in einer sozial unsicheren Gesellschaft besser und leichter zu orientieren, wurden allgemeingültige Regeln gesucht, nach denen sich alle zu richten haben. Die Wissenschaftler sammelten immer mehr Einzelinformationen, die sie strukturieren wollen. Die zufälligen Einzelereignisse sollten auf Naturgesetze zurückgeführt werden. Die Wissenschaftler suchten nach Allgemeingültigkeit. Und diese Allgemeingültigkeit basierte zwangsläufig auf einer Homogenisierung. Alles wurde zunehmend nach demselben Raster eingeteilt, bewertet, erfasst und analysiert. Die einheitlichen verbindlichen Raster, die extra zu diesem Zweck konstruierten Muster, schufen die Voraussetzung, um überhaupt so etwas wie Allgemeingültigkeit und prinzipielle Vorhersagbarkeit entstehen zu lassen.
Der „Durchschnittsmensch“ ist natürlich kein realer Gegenstand wie ein Baum oder Auto. Er ist eine Konstruktion, die einen Zusammenhang herstellt zwischen unvorhersehbaren Aspekten, von zufälligen Erscheinungen, von individuellen Eigenschaften auf der einen Seite und einer Regelmäßigkeit, einer statistischen Zusammenfassung auf der anderen Seite. Durch dieses Konstrukt können die zufälligen, individuellen Eigenschaften in eine allgemeine, regelhafte Eigenschaft überführt werden. Über dieses Konstrukt wird dann gesprochen wie über einen konkreten Gegenstand. Wenn wir uns auf der einen Seite 20 Millionen Menschen vorstellen, die alle unterschiedlich aussehen und handeln, und auf der anderen Seite einen Durchschnittsmenschen, der quasi im Namen aller Menschen einige Eigenschaften verkörpert, dann erkennen wir das Ausmaß der Nivellierung. Wenn wir jetzt noch bedenken, dass bei Millionen Menschen stabile statistische Regelmäßigkeiten auftreten, dann begreifen wir das Potential. Wir können nämlich jetzt den Durchschnittsmenschen objektivieren. Wir können ihn vermessen und zwischen Gesellschaften oder Gruppen vergleichen. Wir können die Veränderungen im Zeitverlauf untersuchen und vieles mehr. Es scheint, als ob die durch Mittelwerte erzeugten Gegenstände genauso untersuchbar sind, wie eine Lunge, ein Wald, ein Käfer oder das Wetter. Auch wenn der Durchschnittsmensch bereits damals sehr umstritten war, haben wir uns heute mit solchen statistischen Begriffen arrangiert und eine neue Welt an Kuriositäten geschaffen.
Das ist der hohe Preis, den wir gezahlt haben, um Vergleichbarkeit und einen Fortschritt der Wissenschaften zu erreichen. Dieser Konflikt zwischen dem konkreten Individuum, das vor mir steht, und dem Regelmenschen, der in Studien in bestimmter Hinsicht auf Medikamente oder Operationen reagiert, ist unaufhebbar. Dieser nicht-auflösbare Konflikt besteht zwischen dem Konkreten und Abstrakten, zwischen dem Individuellen und Allgemeinen. Für das konkrete Individuum kann ein Ereignis nicht sicher vorhergesagt werden, aber wenn die Anzahl ausreichend groß ist, dann entsteht ein mittlerer Wert mit einer bestimmten Schwankungsbreite. Das ist alles, was wir bekommen. Im konkreten Fall ist damit nichts zu gewinnen. Schieße ich auf einen Hasen und schieße einen Meter rechts vorbei, habe ich nichts getroffen. Schieße ich noch einmal und dieses Mal einen Meter links vorbei, habe ich auch nichts getroffen. Statistisch gesehen, ist der Hase dagegen tot. Nur satt werden wir davon nicht.