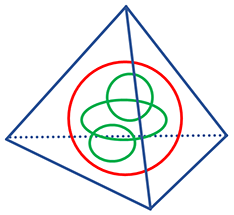Nikotin
Raucher haben ein deutlich höheres Risiko eine infektiöse Komplikation zu erleiden. Dieser Sachverhalt trifft nicht nur für pulmonale Komplikationen zu, die zwei- bis sechsmal so häufig sind, sondern auch für Wundheilungsstörungen. Ohne Zweifel wäre es günstiger, wenn Patienten nicht rauchen oder bereits vor längerer Zeit mit dem Rauchen aufgehört hätten. Leider trifft dieses weder für die Notfalloperationen noch elektiven Operationen zu.
Pathophysiologie
Rauchen führt nicht nur zu einer verminderten Mikrozirkulation mit konsekutivem gestörten Metabolismus, sondern auch zu einer deutlich schlechteren Wundheilung. Dies beruht unter anderem auf einer gestörten zelluären Immunreaktion und schlechteren Prolifertaion von Fibroblasten mit kosekutiver Kollagenbildungsstörung. Rauchen erhöht das Risiko von Nekrosen, Wundinfektionen und verzögerten Heilung.
Präoperativer Nikotingenuss
Es ist keine Frage, dass eine zweimonatige Abstinenz vom Rauchen die pulmonalen und infektiösen Komplikationen vermindert. Nach spätestens acht Wochen Abstinenz (einschließlich passivem Rauchen) verbessern sich bereits die Compliance der Lunge, das inspiratorische Reservevolumen und die funktionelle Residualkapazität. Das pulmonale Abwehrsystem erholt sich aber nicht so schnell. Es scheint noch länger beeinträchtigt zu sein. Dennoch reichen zwei Monate aus, um die pulmonalen Komplikationen deutlich zu vermindern. Rauchen steigert den sympathoadrenergen Tonus und vermindert die Sauerstofftransportkapazität des Blutes, weil sich der Anteil des Kohlenmonoxidhämoglobins (COHb) erhöht hat. Beide Faktoren erhöhen das Risiko einer Myokardischämie (intraoperative ST-Senkungen), wobei die Wahrscheinlichkeit einer ST-Senkung und die COHb-Konzentration im Blut eng korreliert sind. Allerdings scheint bereits eine sechs- bis neunstündige Abstinenz den COHb-Wert drastisch zu vermindern und damit das kardiale Risiko zu senken.
Anästhesie
Früher wurden Patienten, die geraucht haben, als nicht mehr nüchtern angesehen, weil eine vermehrte Magensekretion, schlechtere Magenentleerung und verminderter Tonus am Mageneingang postuliert wurden. Man befürchtete vermehrte Aspirationen. Diese Veränderungen normalisieren sich aber einige Minuten nach dem Nikotingenuss, so dass ein präoperativer Konsum nicht die Aspirationsgefahr erhöht.
Wundheilungsstörungen
Es ist nicht eindeutig geklärt, ob die geschwächte Immunabwehr als solche oder die ausgelöste Vasokonstriktion primär für die nachweisbare Häufung von Wundheilungsstörungen verantwortlich ist. Da die Problem aber auch bei Verschiebelappenplastiken auftreten, dürfte primär eine gestörte Mikrozirkulation die Probleme verursachen. Eine Karenz von mindestens drei bis vier Wochen hat sich als vorteilhaft erwiesen. Damit ließen sich die infektiösen Komplikationen in der orthopädischen Chirurgie von 30 % auf 5 % reduzieren.
Alkohol
Auch ein chronischer Alkoholgenuss von mehr als 60 g Ethanol täglich ist ein wichtiger Risikofaktor, wobei es nicht erst die fortgeschrittene Leberzirrhose sein muss, die mit Gerinnungsstörungen und Thrombozytopenie einhergeht. Diese Menge Alkohol wirkt sich auf fast alle Organsysteme aus. Daraus entwickelt sich ein zwei- bis fünffach höheres Risiko eine schwere Komplikation zu erleiden.
Folgestörungen
Herzrhythmusstörungen, moykardiale Ischämien und Kardiomyopathien sind relativ häufig und schränken die kardiovaskuläre Reserve ein. Der begleitende Leberschaden verschlechtert nicht nur die Blutgerinnung, sondern die gesamte Wundheilung. Die kompromittierte Immunabwehr erhöht das Infektionsrisiko (Pneumonien, Harnwegs- und Wundinfekte) um ein Mehrfaches.
Anamnese
Die Diagnose wird außer bei akuter Intoxikation durch eine sorgfältige Anamnese gestellt. Sie ist aber nicht immer eindeutig, weil viele Patienten ihren chronischen Alkoholgenuss verneinen. Spezielle Fragebögen (CAGE oder AUDIT) wurden entwickelt, um das Ausmaß der Abhängigkeit zu ermitteln. Allerdings setzt die Beantwortung auch die Mitwirkung des gewillten Patienten voraus, was nicht immer gewährleistet ist. Trotzdem sollte man sich die Zeit nehmen und den Patienten gezielt befragen, wenn man einen konkreten Verdacht hegt, damit unvorhergesehene postoperative Verläufe besser interpretiert werden können. Die Diagnose wird unterstützt, wenn die GGT, das mittlere korpuskulare Volumen der Erythrozyten oder das kohlenhydratdefiziente Transferrin erhöht sind.
Alkoholentzugssyndrom
Das Alkoholentzugssyndrom kann sich unbehandelt zu einem lebensbedrohlichen Zustand entwickeln. Es reicht von einfachen vegetativen Symptomen bis zum Delirium tremens. Halluzinationen und kognitive Störungen sind häufig. Bevor man diese Diagnose stellt, sollten alle anderen relevanten Krankheitsbilder und Komplikationen ausgeschlossen sein. Zur Therapie werden primär Benzodiazepine eingesetzt. Bei vegetativen Symptomen hat sich Clonidin bewährt und bei psychotischen Komponenten Haloperidol. Die Dosierungen richten sich nach dem klinischen Bild.