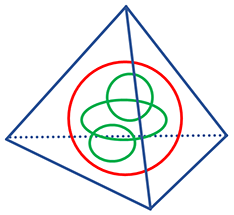Risikoeinschätzung
Allgemeine Risiken
Indikationsstellung
Bevor der Chirurg dem Patienten zu einer Operation raten kann, sollte er das allgemeine und spezielle Risiko der Operation gegen den Nutzen für den Patienten abwägen. Die abschließende Risikoeinschätzung und die Indikationsstellung obliegen ausschließlich dem Chirurgen, denn er muss die Operation vor dem Patienten verantworten. Selbstverständlich wird sich der Chirurg von den Empfehlungen der Kollegen anderer Disziplinen leiten lassen, bevor er eine Entscheidung trifft. Es gehört zum unabdingbaren chirurgischen Wissen, die Risiken für den Eingriff abzuschätzen. Die Operationsindikationen für größere und komplexe Eingriffe können nur ein erfahrener Chirurg und kein unerfahrener Assistent stellen. Erst wenn die nötigen klinischen und operativen Erfahrungen vom jungen Kollegen gesammelt wurden, wird er selbst gute Indikationsentscheidungen treffen können.
Operationsrisiko
Da die speziellen Operationsrisiken in den einzelnen Organkapiteln präsentiert werden, soll an dieser Stelle nur auf die allgemeine Risikoabschätzung eingegangen werden. Dabei sind der gegenwärtige Zustand des Patienten und alle Erkrankungen zu berücksichtigen. Erst die vollständige Würdigung aller Befunde lässt erkennen, ob der Patient vom operativen Eingriff profitieren kann, und welches perioperative Risiko tatsächlich besteht. Der Wunsch des Patienten darf keinesfalls alleinige Richtschnur sein.
Risikofaktoren
Die relevanten Erkrankungen des Patienten werden aber nicht nur erfasst, um das Risikoprofil zu bestimmen, sondern es wird zugleich geprüft, ob die bisherige Behandlung präoperativ noch verbessert werden kann, um das Risiko zu vermindern. Die kardiovaskulären und pulmonalen Erkrankungen stehen ohne Zweifel ganz im Vordergrund, weil sie perioperativ direkt das Leben des Patienten gefährden. Aber auch ein insulinpflichtiger Diabetes mellitus, eine chronische Niereninsuffizienz, ein Alkohol- und Nikotinabusus o. ä. erhöhen die Komplikationen und die Sterblichkeit nach einem operativen Eingriff. Deshalb sollten alle relevanten Risikofaktoren erfasst werden. Im Folgenden werden seltenere Risiken, wie Blutgerinnungsstörungen, Bestrahlungsfolgen, Immunsuppressiva o.ä. nicht weiter im Detail besprochen. Sie müssen aber unbedingt bei der Gesamtbeurteilung als relevante Einflussgrößen gewürdigt werden.
Sterblichkeit
Von nicht-operativen Disziplinen werden häufig fast ausschließlich die kardiopulmonalen Probleme in der präoperativen Evaluation berücksichtigt, weil sie zum Tode führen können. Es ist aber aus chirurgischer Sicht geboten, alle postoperativen Komplikationsmöglichkeiten und die nachfolgende Lebensqualität bei der Operationsindikation und Wahl des geeigneten Verfahrens zu berücksichtigen. Würde z.B. ein Risikopatient leichtfertig wegen einer nichtmalignen Krankheit operiert und mit einer Anastomoseninsuffizienz, Peritonitis, einem Stoma und offenem Abdomen überleben, dann wiegt die sich daraus ergebende schlechte Lebensqualität mindestens genauso schwer. Es wäre eine verkürzte Sichtweise, die in den Organkapiteln beschriebenen operationsbedingten Komplikationen nicht zu berücksichtigen. Ein Diabetes mellitus, eine chronische Niereninsuffizienz oder Immunsuppression hat für den Operateur eine andere Bedeutung als für den Anästhesisten oder Kardiologen. Deshalb obliegt die Gesamtverantwortung der Operation auch dem Chirurgen und nicht dem Anästhesisten, Kardiologen oder Pulmologen.
Risikoabschätzung
Die Risikoabschätzung basiert zunächst ausschließlich auf der Anamnese und klinischen Untersuchung. Weitere Untersuchungen sind nur erforderlich, wenn sie tatsächlich praktisch relevant sind, d.h. wenn sie das operative Vorgehen wirklich verändern oder die perioperative Behandlung entscheidend mitgestalten würden. Die gesamte präoperative Evaluation des Patienten hat nicht den Zweck, „den Patienten zur Operation freizugeben“, sondern es soll der gegenwärtige Gesundheitsstatus des Patienten gewürdigt werden. Nur indem wir wissen, wie es um den Patienten bestellt ist, können wir das geeignete Behandlungsverfahren wählen, sinnvolle prophylaktische Verfahren einleiten, um Komplikationen zu minimieren, und dem Patienten die beste perioperative Therapie bieten.
Präoperative Evaluation
Die Anamnese ist zunächst richtungsweisend, denn die meisten Patienten mit ernsthaften Begleiterkrankungen werden bereits behandelt. Bei einer völlig leeren Anamnese und normaler körperlicher Belastbarkeit ist ein erhöhtes Risiko sehr unwahrscheinlich. Die klinische Untersuchung ist der zweite Schritt, der zur Beurteilung zwingend erforderlich ist. Hier sollten sich relevante pulmonale und kardiale Probleme soweit offenbaren, dass sie einer zielgerichteten Diagnostik zugeführt werden können – falls erforderlich. Nach gründlicher Anamnese und Untersuchung sollte eigentlich eine grobe Einschätzung des Gesamtrisikos möglich sein. Die weitere apparative Diagnostik gilt nicht der erneuten Bestätigung der bekannten Diagnosen des Patienten. Weitere Untersuchungen sollen nur vorgenommen werden, wenn sie das therapeutische Vorgehen verändern bzw. beeinflussen könnten. Untersuchungen aus rein „akademischem“ Interesse anzuordnen ist gefährlich, weil sich aus den Untersuchungsergebnissen möglicherweise risikobehaftete Folgeeingriffe bzw. -behandlungen ergeben.
Routineuntersuchungen
Es besteht heute weitgehende Einigkeit, dass Routineuntersuchungen bei allen Patienten ab einem bestimmten Alter nicht indiziert sind. Es sollten grundsätzlich nur risikoadaptierte Untersuchungen vorgenommen werden – erst die Anamnese und klinische Untersuchung und dann die apparativen Untersuchungen.
Klinisches Risiko
Um überflüssige Untersuchungen zu vermeiden, sollte vor jeder zusätzlichen apparativen Diagnostik die körperliche Belastungsfähigkeit abgeklärt werden. Dazu hat es sich bewährt, den Patienten zu fragen, wie viele Etagen er Treppensteigen kann oder könnte, und ob er dabei Schmerzen oder Luftnot verspürt. Ein Patient, der drei bis vier Etagen locker steigen kann, hat in der Regel keine relevante kardiopulmonale Erkrankung, so dass weitere Untersuchungen entfallen können. Gibt der Patient dagegen bereits nach zwei Etagen Luftnot oder Schmerzen an, ist eine detaillierte Aufarbeitung der kardiopulmonalen Risiken erforderlich. Wenn der Patient selbst eine Treppe nicht steigen kann, dann ist das Risiko hoch. Man sollte hellhörig werden, wenn der Patient wegen Gelenkbeschwerden immer nur den Fahrstuhl benutzt.
Laboruntersuchungen
Wenn man sicher wüsste, dass jemand gesund ist, dann wären alle Laboruntersuchungen überflüssig. Bei Patienten ohne Risiko, leerer Anamnese und kleinen Eingriffen kann deshalb auf Laborwerte vollständig verzichtet werden. Ansonsten sollten mindestens folgende Laborwerte vorliegen: Blutbild, Kalium, Kreatinin. Bei allen großen gastrointestinalen Operationen sollte zusätzlich das Gesamteiweiß bestimmt werden, um eine Mangelernährung auszuschließen, bei Operationen am Pankreas zusätzlich die Lipase, und bei allen Operationen an der Leber und den Gallenwegen GOT, GGT, AP und Bilirubin. Ansonsten werden zusätzliche Laborwerte nur bei entsprechendem Krankheitsbild veranlasst. Verfügt der Patient weder über einen Blutgruppenausweis noch über ein gleichwertiges Dokument, dann wird die Blutgruppe bestimmt, wenn mindestens ein mittelgroßer Eingriff geplant wird.
Kardio-pulmonale Risiken
Kardiale Risiken
Postoperative kardiale Komplikationen sind deshalb so bedeutend, weil sie zum akuten Herzinfarkt oder Herzstillstand führen können, die in ungefähr 50 % der Fälle tödlich verlaufen. In umfangreichen Sammelstatistiken wurden folgende Faktoren als unabhängige Einflussgrößen nachgewiesen, eine schwere kardiale Komplikation zu erleiden: ASA-Stadium >2, Notfalloperationen, langdauernde komplexe Operationen, frühere Herzinsuffizienz, niedriges Albumin, niedriger Hämatokrit oder chronische Niereninsuffizienz.
ASA-Klassifikation
Bei der Beurteilung des Gesamtzustandes des Patienten hat sich die Klassifikation der American Society of Anesthesiology (ASA) durchgesetzt, zumal die schweren Komplikationen fast ausschließlich bei Patienten mit ASA >2 auftreten. Mit der ASA-Klassifikation kann der allgemeine Zustand grob abgebildet werden. Allerdings ist er ungeeignet, um das Risiko genauer zu bestimmen.
| ASA 1 | Normaler, gesunder Patient |
| ASA 2 | Leichte Allgemeinerkrankung |
| ASA 3 | Schwere Allgemeinerkrankung mit Leistungsminderung |
| ASA 4 | Schwere Allgemeinerkrankung mit ständiger Lebensbedrohung |
| ASA 5 | Moribunder Patient, der voraussichtlich innerhalb von 24 Std. stirbt. |
Herzinsuffizienz
Da die kardialen Risiken (Herzinsuffizienz und Angina pectoris) die größte Bedeutung haben, sollten sie besonders genau erfasst werden. Die Herzinsuffizienz wird in vier Schweregrade gemäß der New York Heart Association (NYHA) eingeteilt. Da bei einer Herzinsuffizienz das Gewebe nicht adäquat mit Blut versorgt wird, ist bei zunehmender Insuffizienz mit einer drastischen Steigerung der Komplikationen und Sterblichkeit zu rechnen. Bei guter medikamentöser Behandlung ist meistens keine weitere Verbesserung des Patienten wahrscheinlich. Eine frühere dekompensierte Herzinsuffizienz ist ein sehr ernst zunehmender Hinweis. Eine Kardiomyopathie oder Herzklappenerkrankung bedürfen genauso einer kardiologischen Abklärung wie Patienten mit einem Schrittmacher oder Defibrillator.
NYHA-Klassifikation
| NYHA 1 | Beschwerdefrei. Beschwerden nur bei außergewöhnlicher Belastung |
| NYHA 2 | Beschwerdefrei bei üblicher körperlicher Belastung. Beschwerden bei höherer Belastung mit Leistungseinschränkung |
| NYHA 3 | Beschwerden bei üblicher körperlicher Belastung mit deutlicher Leistungseinschränkung |
| NYHA 4 | Ruhebeschwerden mit massiver Leistungseinschränkung |
Angina pectoris
Eine Angina pectoris erhöht das perioperative Risiko einer kardialen Ischämie mit nachfolgendem Pumpversagen ebenfalls erheblich. Sie kann gemäß der Canadian Cardiovascular Function Classification (CCS) eingeteilt werden, die nachweislich sehr gut mit den postoperativen Ergebnissen korreliert.
| Grad 1 | A.p. nur bei sehr schwerer körperlicher Belastung |
| Grad 2 | A.p. bei > 1 Etage Treppe steigen in normaler Geschwindigkeit, sowie geringe Einschränkung der alltäglichen körperlichen Belastbarkeit |
| Grad 3 | Angina pectoris bei 1 Etage Treppe steigen, sowie deutliche Einschränkung der alltäglichen körperlichen Belastbarkeit |
| Grad 4 | Angina pectoris bei jeder Belastung ggf. auch in Ruhe. |
Hypertonie
Ein gut eingestellter arterieller Hypertonus erhöht in der Regel nicht das perioperative Risiko. Häufig ist die Hypertonie nur Bestandteil des metabolischen Syndroms. Ein systolischer Druck über 180 mmHg oder diastolischer Druck über 110 mmHg bedürfen der intensiven Behandlung und sollten unbedingt optimiert werden.
Betablocker/Statine
Bei Patienten mit einem kardiovaskulären Risiko sollte überprüft werden, ob sie eventuell von einer Betablockade profitieren könnten. Bei der Indikationsstellung sind einerseits die Kontraindikationen zu beachten und andererseits der Nutzen, der bisher nur bei Patienten belegt ist, die bereits an kardiovaskulären Krankheiten leiden. Theoretisch sollte bei allen Patienten, die dem Kardiologen wegen der Risikofaktoren vorgestellt werden, geprüft werden, ob ein Betablocker gegeben werden sollte. Die Einnahme ist präoperativ zu beginnen und postoperativ für einen Monat fortzusetzen. Die Dosierung der Betablocker wird soweit gesteigert, dass eine Herzfrequenz von 50–60 pro Minute in Ruhe erreicht wird. Häufig wird mit der Blockade erst direkt postoperativ begonnen und bis zum Ende des stationären Aufenthaltes fortgeführt. Sollte der Patient bereits Statine einnehmen, dann sollte die Einnahme perioperativ unbedingt fortgeführt werden.
Operationsrisiko
Das Risiko, nach einer Operation eine ernste kardiale Komplikation zu erleiden, hängt nicht nur von den Vorerkrankungen ab, sondern auch vom chirurgischen Eingriff. Notfalleingriffe sind besonders risikobehaftet. In der Viszeralchirurgie handelt es sich dabei häufig um septische Patienten mit massiven Flüssigkeitsverschiebungen. Größere abdominale Eingriffe sind unter elektiven Bedingungen nicht ganz so risikobehaftet, besonders wenn sie laparoskopisch vorgenommen werden.
Risikostratifizierung
Das kardiale Risiko kann sehr effektiv nach dem revidierten kardialen Risiko-Index (Circulation 1999; 100: 1043) beurteilt werden. Dieser Index ist etwas einfacher als die Beurteilung nach den Leitlinien des American College of Cardiology. Er berücksichtigt aber nicht die sehr schweren Krankheitsbilder wie eine dekompensierte Herzinsuffizienz oder instabile Angina pectoris, die ein dringliches Handeln und extrem sorgfältiges Abwägen erfordern. Wenn man von den angeführten Risiken keine oder nur eine aufweist, beträgt das Risiko unter 1 %, eine schwere kardiale Komplikation (Infarkt, Lungenödem, schwere Arrhythmie, Herzstillstand) zu erleiden. Bei zwei Risiken steigt die Wahrscheinlichkeit auf 7 % und bei mehr als 2 Risiken sogar auf 11 %. Patienten mit drei oder mehr Risiken sollten unbedingt einem Kardiologen vorgestellt werden. Bei einem extrem hohen Risiko sollte eine Operation möglichst vermieden werden. Aber auch bei einem niedrigen Risiko sollte überprüft werden, ob die bisherige Therapie optimal erscheint. Wenn nicht, dann sollte eine entsprechende Therapie eingeleitet und die Operation verschoben werden.
Revidierter kardialer Risiko-Index
| Operationen mit hohem Risiko (Intraperitoneal oder -thorakale Eingriffe, zentrale Gefäßeingriffe) |
| Bekannte ischämische Herzkrankheit (z.N. HI, instabile Angina, pathol. EKG) |
| Herzinsuffizienz (stabile oder dekompensierte Insuffizienz) |
| Cerebrovaskuläre Insuffizienz (Z.n. TIA/Apoplex) |
| Insulinpflichtiger Diabetes mellitus |
| Niereninsuffizienz (Kreatinin 2 mg/dl) |
Bei 2 Risikofaktoren beträgt die Wahrscheinlichkeit 7% und bei mehr als 2 Risikofaktoren 12%, eine schwere kardiale Komplikation zu erleiden.
EKG
Ein Ruhe-EKG ist erforderlich, wenn die Anamnese oder die klinische Untersuchung Hinweise auf eine kardiale Vorerkrankung ergeben, wenn kürzlich thorakale Schmerzen auftraten, der Patient längere Zeit an Diabetes mellitus oder einer arteriellen Verschlusskrankheit leidet, oder es sich um einen Patienten mit mittleren oder hohem Risiko handelt. Voruntersuchungen, die nicht älter als sechs Monate sind, brauchen nicht wiederholt zu werden. Sollte allerdings der Verdacht bestehen, dass sich die kardiale Erkrankung verschlechtert hat, dann ist ein erneutes EKG anzufertigen. In Abhängigkeit vom klinischen Risiko und den kardialen Erkrankungen des Patienten kann eine vollständige kardiologische Abklärung notwendig werden. Bei einer schlechten linksventrikulären Funktion, bekannter schwerer Herzinsuffizienz oder Dyspnoe unklarer Genese ist eine Echokardiographie sinnvoll. Die Indikationen für weitere Belastungstests oder die Koronarangiographie stellt in der Regel der Kardiologe. Im Zweifel wird die kardiale Diagnostik in Absprache mit dem Kardiologen eher ausgedehnt als eingeschränkt.
Pulmonale Risiken
Wenn eine obstruktive oder restriktive Lungenerkrankung vorliegt, dann erhöht sich das Risiko, eine respiratorische Komplikation zu erleiden. Die nachfolgende Hypoxämie, Azidose oder zusätzliche Atemarbeit verschlechtert die Herzkreislauf-Situation beträchtlich. Wenn COPD, Asthma bronchiale oder sonstige pulmonale Erkrankung bekannt sind, dann sollte eine aktuelle Röntgenaufnahme des Thorax vorliegen, wenn eine Verschlechterung eingetreten ist. Eine Spirometrie ist zur Behandlungskontrolle vor großen Eingriffen sinnvoll, um die funktionelle Kapazität und Reaktion auf Bronchodilatatoren zu beurteilen. Durch eine Blutgasanalyse könnte eine CO2-Retention nachgewiesen werden. Alle Befunde sollten relativ aktuell sein (einige Monate). Kürzlich eingetretene Verschlechterungen erfordern eine neue vollständige pulmologische Untersuchung.
Thorax
Eine Röntgenuntersuchung des Thorax in zwei Ebenen zusätzlich zur Auskultation ist nur dann erforderlich, wenn die Anamnese oder die klinische Untersuchung Hinweise auf eine pulmonale Vorerkrankung ergeben, die optimierbar erscheint. Voruntersuchungen, die nicht älter als drei Monate sind, brauchen nicht wiederholt zu werden. Außerdem sollte zum Staging bei Malignomen eine Röntgenaufnahme angefordert werden, um Lungenmetastasen auszuschließen.
Hepato-renale Risiken
Niereninsuffizienz
Die chronische Niereninsuffizienz ist ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor, der maßgeblich mit Komplikationen assoziiert ist. Der Grad der Niereninsuffizienz kann heute leicht durch die errechnete glomeruläre Filtrationsrate (GFR) bestimmt werden. Bei einer GFR unter 30 ml/min sollte perioperativ gewissenhaft die Nierenfunktion überprüft und die Dosierung von Medikamenten angepasst werden, um ein manifestes Nierenversagen zu verhindern bzw. zu erkennen. Dazu bietet sich die online-Berechnung der optimalen Dosierung unter www.dosing.de an. Besonders problematisch ist die Kombination eines ACE-Hemmers mit einem nicht-steroidalen Antiphlogistikum (NSAR). Bei einer GFR unter 60 ml/min sollte man bei gleichzeitiger Einnahme eines ACE-Hemmers oder sonstigen hypotonen Zuständen die NSAR meiden. Sollte die GFR sogar weniger als 30 ml/min betragen, wird grundsätzlich auf NSAR verzichtet (s. Schmerztherapie).
Die Nierenfunktionsleistung wird in Abhängigkeit von der GFR in folgende Stufen eingeteilt:
| Stufe 1 | GFR > 90 bedeutet normale oder erhöhte GFR |
| Stufe 2 | GFR 60-89 bedeutet geringgradiger Funktionsverlust |
| Stufe 3 | GFR 30-59 bedeutet mittelgradiger Funktionsverlust |
| Stufe 4 | GFR 15-29 bedeutet schwerer Funktionsverlust |
| Stufe 5 | GFR < 15 bedeutet Nierenversagen |
Lebererkrankungen
Inwieweit eine Lebererkrankung bei der Operationsplanung zu berücksichtigen ist, hängt vom Ausmaß der Erkrankung und dem geplanten Eingriff ab. Zu berücksichtigen ist einerseits der veränderte Metabolismus, so dass alle Medikamente an diese Situation adaptiert werden müssen, die verminderte Syntheseleistung der Leber mit Eiweißmangel und Gerinnungsstörungen und die Änderungen der Hämodynamik (Hypotonie und Volumenbelastung).
Risikoeinschätzung
Die üblichen Laborwerte (GOT, GPT) sind zur Risikoeinschätzung ungeeignet. Die Exkretionsleistung und Cholestase kann mit dem Bilirubin, der alkalischen Phosphatase und der Gamma-Glutamyl-Transferase eingeschätzt werden. Die Syntheseleistung kann mit dem Albumin, der Cholinesterase und der Blutgerinnung beurteilt werden. Quantitative Leberfunktionsmessungen wie die Indozyaningrün-Plasmaverschwinderate korrelieren gut mit der Leberfunktion. Um das Risiko der der 1-Jahres-Sterblichkeit abschätzen zu können, werden bei der Leberzirrhose der modifizierte Child-Pugh-Score und neuerdings auch der MELD-Score eingesetzt (s. Kapitel 10).
Operationsrisiko
Patienten mit einer eingeschränkten Synthesestörung haben eine deutlich höhere Komplikationsrate. Blutungskomplikationen und Infektionen sind sehr häufig und Anastomosen heilen schlecht. Die Sterblichkeit ist bei asymptomatischen Patienten mit einer Lebererkrankung nicht sehr viel höher. Erst bei einer fortgeschrittenen Leberzirrhose oder Leberresektion steigt die Sterblichkeit. Bei einer hepatischen Enzephalopathie ist mit einer 35fachen Sterblichkeit zu rechnen
Hämostase
Störungen der Hämostase
Perioperative Blutungen sind äußerst unerwünschte Komplikationen, die primär immer dem Chirurgen zur Last gelegt werden, obwohl die Ursache sowohl chirurgisch als auch hämostaseologisch bedingt sein könnte. Einige Blutungen werden intraoperativ zum Beispiel durch eine Verdünnungskoagulopathie, Hypothermie oder Azidose hervorgerufen. Andere basieren auf bereits präoperativ bestehenden Störungen der Hämostase.
Präoperative Abklärung
Es ist für den Operateur sehr wichtig, Störungen der Hämostase durch eine gezielte präoperative Diagnostik zu erkennen und zu behandeln. Erst wenn diese Störungen hinreichend bekannt sind, kann das Risiko des Eingriffes richtig beurteilt werden, und nur wenn die Störung auch ausreichend behandelt worden ist, kann das Risiko einer perioperativen Blutung minimiert werden. Früher bestand die Diagnostik aus der routinemäßigen Messung von drei Werten: Thrombozytenzahl, partielle Thromboplastinzeit (aPTT) und Thromboplastinzeit nach Quick (Quick). Mit der Messung dieser Werte sollte quasi der hämostaseologische Status abgefragt werden. Waren die Werte in Ordnung, dann wurden keine Blutungsstörungen vermutet. Bedauerlichweise sind diese Laborparameter nur in äußerst seltenen Fällen geeignet, Störungen der Hämostase vorherzusagen. Genau genommen ist die Bestimmung dieser Laborwerte unbedeutend, denn selbst wenn die Werte normal sind, kann eine massive Blutungsstörung vorliegen. Die relativ häufigen Blutungskomplikationen, hervorgerufen durch Thrombozytenaggregationshemmer, durch das von-Willebrand-Jürgens-Syndrom oder durch den Faktor-XIII-Mangel, werden nämlich mit den globalen Laborparametern überhaupt nicht erfasst.
Ursachen für niedrigen Quick-Wert
| Vitamin-K-Antagonist |
| Vitamin-K-Mangel |
| Hepatopathie |
| Verbrauchskoagulopathie |
| Hypo-/Dysfibrinogenämie |
Ursachen für verlängerte aPTT
| Hepatin |
| Hirudin |
| Hepatopathie |
| Hämophilie A oder B |
| Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom |
Blutungsanamnese
In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass eine sorgfältige standardisierte Blutungsanamnese eine deutlich höhere Vorhersagekraft von hämostaseologischen Problemen aufweist als die oben genannten globalen Laborparameter. Die Anamnese sollte dabei aber nicht beliebig erhoben werden, sondern die wichtigsten Ereignisse abfragen. Dazu gehören unter anderem das Auftreten spontaner Blutungen (Nasen- oder Zahnfleischblutungen), verlängerte Regelblutung bei Frauen, blaue Flecken nach Bagatelltraumen, längeres Bluten nach Schürf- oder Schnittwunden, frühere postoperative Blutungskomplikationen oder Gabe von Blutprodukten, familiäre Hämostasestörung oder die Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern. Bei dieser sehr wichtigen Anamnese sind standardisierte Erhebungsbögen sehr hilfreich.

Gezielte Gerinnungsdiagnostik nach Anamnese
Laboruntersuchungen
Die weitere Labordiagnostik richtet sich nach der Anamnese und sollte mit einem Hämostaseologen abgesprochen werden. Wenn die Anamnese völlig leer ist, dann sind bei Patienten mit einer ASA-Klassifikation 1 oder 2 keine weiteren Gerinnungsuntersuchungen erforderlich, auch bei einer geplanten Regionalanästhesie nicht. Bei den kränkeren Patienten mit ASA 3 oder 4 sollten die klassischen Globalparameter kontrolliert werden, die ergänzt werden durch die Messung der Thrombozytenfunktion. Bei einer auffälligen positiven Blutungsanamnese, die wahrscheinlich bei 10% aller Patienten nachweisbar ist, sollte nach der Ursache gesucht werden. Eine Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten und die meisten angeborenen Störungen sind in der Regel bekannt. Am häufigsten liegt eine medikamentöse Thrombozytopathie vor. Die meisten Patienten nehmen gezielt einen Thrombozytenaggregationshemmer (ASS oder Clopidogrel) ein. Andere Patienten wissen dagegen gar nicht, dass in einigen Kombinationspräparaten auch ASS enthalten ist. Manchmal überrascht das von Willebrand-Jürgens-Syndrom.
Gerinnungsdiagnostik
Die globalen Parameter sind bei einer positiven Blutungsanamnese nicht ausreichend. In diesen Situationen sollte immer die Thrombozytenfunktion bestimmt werden, weil die primäre Hämostase am häufigsten betroffen ist. Dazu eignet sich der PFA-100 (Plättchen-Funktions-Analyse), der die wichtigsten Blutungsursachen abdeckt, aber leider nur wenig empfindlich für Clopidogrel ist. Allerdings lassen sich selbst durch diese Verfahren nicht alle Blutungskomplikationen sicher vorhersagen, weil Blutungen auch durch andere Faktoren beeinflusst werden. Sind der Quick erniedrigt oder die aPTT verlängert, dann sollten unbedingt die Ursachen herausgefunden und möglichst optimal behandelt werden.
Blutungsursache
Neben den hämostaseologischen Störungen werden Blutungen durch Eigenschaften des Patienten, durch die Fähigkeiten des Chirurgen und den operativen Eingriff verursacht. Es ist die Aufgabe einer funktionierenden präoperativen Vorbereitung, diese Faktoren positiv zu beeinflussen. Sollte eine Thrombozytopathie nachgewiesen worden sein, dann kann versucht werden, sie zu verbessern (z.B. durch Desmopressin).
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Patienten mit einem behandlungsbedürftigen Diabetes mellitus weisen ein höheres Operationsrisiko auf als metabolisch gesunde Patienten. Besonders Patienten mit diabetischen Spätfolgen und schweren Nebenerkrankungen zeigen eine höhere postoperative Sterblichkeit. Auf typische Begleiterkrankungen des Diabetes mellitus wie Nephropathie, Angiopathie und Neuropathie sind deshalb unbedingt zu achten. Die Patienten leiden häufig an einer KHK, an Herzrhythmusstörungen oder einer Kardiomyopathie sowie peripheren und zerebralen Durchblutungsstörungen. „Stille“ Myokardinfarkte sind nicht selten, so dass bei mangelnder körperlicher Betätigung ein Ruhe-EKG trotz fehlender Beschwerden angezeigt ist. Eine autonome Neuropathie prädisponiert insgesamt zu einer perioperativen Hypotension, Ruhetachykardie oder Orthostase-Problemen. Sie kann auch eine Gastroparese bewirken, die die Magenentleerung verzögert, so dass der Patient unbedingt die präoperative Nahrungskarenz einhalten sollte. Da Nephropathien ebenfalls häufig sind, sollte die glomeruläre Filtrationsrate bestimmt werden. Wenn eine proliferative Retinopathie bekannt ist, sollte der Blutdruck gut eingestellt sein und engmaschig kontrolliert werden, weil hohe Blutdrücke zu Glaskörpereinblutungen führen können.
Präoperative Einstellung
Da die Blutzuckerwerte sowohl in mg/dl als auch in mmol/l angegeben werden, sind immer beide Maßeinheiten angeführt, die sich folgendermaßen umrechnen lassen:
mg/dl x 0,056 = mmol/l und mmol/l x 18,02 = mg/dl
Der Blutzucker sollte vor einem Wahleingriff möglichst gut eingestellt werden. Als Leitwert wird ein HbA1 von unter 7 % angestrebt. Vor der Mahlzeit sollte er 80–110 mg/dl (4,5–6,0 mmol/l), nach der Mahlzeit 100–145 (5,5–8,0) und vor der Nacht 110–130 (6,0–7,5) betragen. Bereits einige Tage präoperativ sind langwirksame Insuline durch kurzwirksame zu ersetzen. Kurz wirkende orale Antidiabetika sollten am Operationstag nicht eingenommen werden. Langwirksame orale Antidiabetika sollten 48 bis 72 Stunden vorher abgesetzt werden. Für die direkte präoperative Phase sollte beim insulinpflichtigen Diabetiker berechnet werden, wie viel Insulin er am Morgen vor der Operation applizieren sollte. Dazu wird zunächst die Insulinbasisdosis berechnet, die der Patient zur Lipolysehemmung und zur Aufrechterhaltung seines Stoffwechsels benötigt. Sie entspricht der Hälfte der täglichen Insulingesamtdosis. Wenn man diese auf vier Tagesdosen aufteilt, dann sind ein Achtel der Insulindosis für den Morgen der Operation erforderlich. Sollte der Patient eine Insulinpumpe besitzen, dann ist diese um ca. 50 % zu reduzieren. Sollte sich am Operationstag die Operation verschieben, sollte individuell und unter Kenntnis des aktuellen Blutzuckerspiegels entschieden werden, wie viel Glucose oder Insulin der Patient erhalten soll.
Metformin
In einigen Leitlinien wird noch empfohlen, das Biguanid Metformin bereits 48 Stunden vor der Operation abzusetzen, weil eine Laktatazidose befürchtet wird. Biguanide sind hervorragende Medikamente, die heute zur Standardtherapie des Typ-2-Diabetes mellitus gehören. Sie hemmen die Glucoseresorption im Darm, vermindern die Gluconeogenese der Leber und erhöhen die Glucoseaufnahme im Muskel. Zusätzlich wirken sie günstig auf die kardiovaskulären Nebenerkrankungen. Metformin wird renal ausgeschieden und kumuliert bei einer Niereninsuffizienz. Leider blockieren Biguanide den Laktatabbau in der Leber, so dass bei vermehrter perioperativer Laktatproduktion eine Laktatazidose drohen kann. Die Biguanide wurden deshalb lange Zeit restriktiv eingesetzt. In jüngster Zeit wird Metformin aber sehr häufig eingesetzt, weil es sehr viel Vorteile bietet. Das Risiko der Laktatazidose wird auf 8–9 auf 100 000 Patientenjahre geschätzt und scheint sich von anderen Therapieformen nicht zu unterscheiden. Da bei normaler Nierenfunktion die Halbwertszeit nur drei Stunden beträgt, braucht Metformin nicht unbedingt 48 Stunden vorher abgesetzt werden.
Postoperative Einstellung
Da eine optimale Einstellung des Blutzuckers die Komplikationen vermindert, wird heutzutage ein perioperativ „normaler“ Blutzucker von 80–160 mg/dl (4,4–8,9 mmol/l) angestrebt. Die früher geübte Praxis der permissiven Hyperglykämie mit Blutzuckerwerten um 200 mg/dl (11,1 mmol/l) ist verlassen worden. Im postoperativen Verlauf soll der Blutzucker aber nicht zu niedrig eingestellt werden, um gefährliche Hypoglykämien zu vermeiden. Das Ziel besteht im Wesentlichen darin, sowohl Hypoglykämien als auch exzessive Hyperglykämien zu vermeiden. Postoperativ wird der Blutzucker im Aufwachraum und danach zunächst alle zwei Stunden kontrolliert. Liegen die Werte im Zielbereich reicht eine Kontrolle alle vier Stunden aus. Besonders sorgfältig ist der Blutzucker zu kontrollieren, wenn nach großen Eingriffen oder entzündlichen Erkrankungen Glucoselösungen gegeben werden (s.u.). Erst wenn der Patient wieder normale Kost zu sich nimmt, wird das präoperative Regime angeordnet. Bei allen Diabetikern ist der Blutzucker regelmäßig, mindestens einmal täglich zu kontrollieren. Zur guten Einstellung sind allerdings vier Blutzucker-Selbstkontrollen erforderlich.
Typ-1-Diabetes
Beim Typ-1-Diabetes muss unbedingt eine Basisinsulinversorgung gewährleistet sein, denn auch im Hungerzustand benötigt der Patient Insulin. Man sollte nicht auf die Hyperglykämie warten, bis Insulin gegeben wird, denn bereits vorher kann eine Ketoazidose auftreten.
Insulintherapie
Von einer Glucose-Insulin-Kalium-Infusion ist auf peripheren Stationen unbedingt abzuraten. Sie können während der Operation oder auf einer Intensivstation erforderlich werden, um den Blutzucker optimal einzustellen. Dabei ist der Blutzucker sehr engmaschig zu kontrollieren, um Hypoglykämien sicher zu vermeiden. Intraoperativ wird Insulin intravenös appliziert, um einen sicheren Effekt zu erreichen, wobei die kurze Halbwertszeit von ca. 5 Minuten zu beachten ist. Eine Einheit Insulin senkt den Blutzucker um ca. 10–50 mg/dl (0,56–2,8 mmol/l). Parallel werden 5- bis 10-prozentige Glucoselösungen infundiert, um eine Hypoglykämie zu verhindern.
Insulinperfusoren
Auf Intensiv- oder Überwachungsstationen werden häufig Insulinperfusoren zur optimalen Blutzuckereinstellungen eingesetzt. Dazu werden zum Beispiel 50 IE Altinsulin auf 50 ml NaCl 0,9% aufgezogen, so dass 1 ml einer Einheit Insulin entspricht. Die kontinuierlich applizierte Insulinmenge richtet sich nach dem aktuellen Blutzuckerwert, der zunächst stündlich gemessen wird, bis der Zielwert erreicht ist. Wenn die metabolische Situation stabil erscheint, dann sind Kontrollen alle zwei oder vier Stunden möglich. Bei einer Veränderung der enteralen oder parenteralen Ernährung sollte allerdings der Blutzucker wieder engmaschig kontrolliert werden. Im eigenen Vorgehen ist ein Insulinperfusor auf der normalen Station verboten. Sollte der Patient zu Untersuchungen oder Behandlungen transportiert werden, dann ist der Insulinperfusor auszustellen.
Korrektur des Blutzuckers
Wenn man unterstellt, dass eine Einheit Altinsulin den Blutzucker um 30 mg/dl vermindert, dann kann die sogenannte 30iger Regel verwendet werden. Wenn der Blutzucker 270 mg/dl und der Zielwert 120 mg/dl betragen, dann wird die Differenz von 150 mit 150/30=5 Einheiten Altinsulin behandelt. betragen der Blutzucker 220 mg/dl und der Zielwert 160 mg/dl, dann sind 60/30=2 Einheiten Altinsulin ausreichend. Diese Dreißiger-Regel hat sich im klinischen Alltag bewährt. Man sollte aber immer daran denken, dass es auch Patienten gibt, deren Blutzucker sich nach einer Einheit Altinsulin nur um 10 mg/dl oder sogar um 50 mg/dl ändert. In diesen Fällen wäre entweder eine Zehner-Regel oder Fünfziger-Regel anzuwenden. Wird in einer Klinik der Blutzucker in mmol/l angegeben, dann sollte eine Zweier-Regel verwendet werden, die bei der Umrechnung einer 36er-Regel entspräche. Es wird mithin vermutet, dass eine Einheit Altinsulin den Blutzucker um 2 mmol/l vermindert. Betragen der Blutzucker 16 mmol/l und der Zielwert 6 mmol/l, dann sollten 5 Einheiten Altinsulin appliziert werden.
Schilddrüse
Schilddrüsenerkrankungen
Hyperthyreose
Eine Hyperthyreose kann das kardiovaskuläre Risiko des Patienten deutlich erhöhen, weil die Schilddrüsenhormone einen inotropen und chronotropen Effekt auf das Herz ausüben. Dadurch steigt sowohl das Herzminutenvolumen als auch die Herzarbeit mit konsekutivem Sauerstoffbedarf. Selten ist eine lebensbedrohliche thyreotoxische Krise, die mit einer Tachykardie, Fieber und Koma einhergeht.
Behandlung
Um die Risiken einer Hyperthyreose zu vermeiden, sollten Wahleingriffe nur bei einer Euthyreose oder geringen Hyperthyreose durchgeführt werden. Bei letzterer kann ein Betablocker notwendig werden. Sollte bei ausgeprägter Hyperthyreose dennoch eine Operation erforderlich werden, ist unverzüglich eine Therapie mit Thyreostatika, Betablocker und Glucokortikoide einzuleiten. Thyreostatika werden einschleichend appliziert. Glucokortikoide sollten hochdosiert (z.B. 3 xl 100 mg Hydrokortison i.-v.) gegeben werden, um die periphere Konversion von T4 zu T3 zu hemmen. Häufig haben diese Patienten nur eine eingeschränkte Nebennierenrindenreserve, so dass die Glucokortikoide auch hier unterstützend wirken.
Hypothyreose
Die moderate Hypothyreose ist trotz der Gefahr einer Herzinsuffizienz oder Hypotonie nicht ganz so gefährlich und leichter zu behandeln als die Hyperthyreose, weil die Zufuhr von L-Thyroxin zielführend ist. Allerdings besteht bei der zu raschen Hormonsubstitution die Gefahr, eine Angina pectoris auszulösen. Schwere Hypothyreosen sollten erst zwei bis drei Wochen behandelt werden, bevor ein Wahleingriff vorgenommen wird.