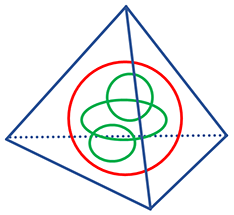Masterarbeit an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften an der Fernuniversität in Hagen am Lehrstuhl für Soziologie III unter der Leitung von Prof. Dr. Sylvia Marlene Wilz.
Horizontale und vertikale Segregation der Geschlechter in der Deutschen Ärzteschaft von 1998 bis 2019
1. Geschlechterdifferenzen in der Gesellschaft
Zur Differenzierung von Männern und Frauen wird gesellschaftlich das Merkmal „Geschlecht“ mit den dichotom geprägten Adjektiven „weiblich“ oder „männlich“ verwendet. Diese Begriffe sind nicht absolut trennscharf – wie die meisten qualitativen Merkmale – und jede morphologische, physiologische oder molekulare Definition führt in einigen Anwendungsfällen zu keiner eindeutigen Zuordnung. Sowohl plurale Lebensformen als auch eine zunehmende Individualisierung erschweren zusätzlich die dichotome Festlegung, was unter einer „Frau“ oder einem „Mann“ verstanden werden soll (vgl. Tonn 2016, 113), und öffnen so den Blick für alternative Kategorisierungen in mehrere Geschlechter, die für die Untersuchung aber unbeachtlich sind.
Das Geschlecht ist sicherlich neben der Generation und Ethnizität eine der wichtigsten Zuordnungskategorien in Urteilen und wird als Geschlechterverhältnis oder -beziehung zwischen Männern und Frauen, als normativ konfigurierte Geschlechterordnung oder als Geschlechterdifferenz thematisiert. Die Relevanz von Geschlecht im sozialen Umgang oder bei der Betrachtung sozialer Ungleichheit ist nicht zwangsläufig gegeben. In einigen sozialen Situationen ist das Geschlecht der Handelnden nicht bedeutsam, aber in anderen handlungsführend.
Inwieweit das Geschlecht tatsächlich eine relevante Einflussgröße für einen Sachverhalt ist oder zu einer solchen werden kann, hängt sowohl von den Rahmenbedingungen als auch der konkreten Situation des zu untersuchenden Sachverhaltes ab. Werden Gesellschaft, Organisationen und Akteure gemeinsam betrachtet, wäre auch noch zu klären, ob der Einfluss des Geschlechts hauptsächlich durch die gesellschaftliche Institutionen auf der Makroebene, durch formelle oder informelle Strukturen der Organisationen auf der Mesoebene oder durch Handlungen der Akteure auf der Mikroebene verursacht wird.
Der biologischen Geschlechtszugehörigkeit entspricht keine allseits akzeptierte natürliche soziale Statuszuordnung, die die wesentlichen Merkmale eines Geschlechtes als „natürliche Konstante“ festlegt. Im Kontext geschlechtersensitiver Untersuchungen wird analytisch zwischen „Sex“ als Geburtsklassifikation, „Sexkategorie“ als soziale Zuordnung zu einem Stereotyp und „Gender“ als intersubjektive Validierung innerhalb von Interaktionen unterschieden (vgl. Gildemeister 2010, 137). Mit „Sex“ wird auf diejenigen (sexuellen) Unterschiede zwischen Personen verwiesen, die auf reproduktive Merkmale beruhen. Mit „Gender“ sind in erster Linie die kulturellen und sozialen Differenzierungen von Personen gemeint, die als „feminin“ oder „maskulin“ bezeichnet werden (vgl. Funk 2018, 18). Im Rahmen dieser Untersuchung werden „Geschlecht“, „Sexkategorie“ und „Gender“ synonym verwendet.
Mit dem Gebrauch von „Geschlecht“ wird auf die Interaktionsebene referiert, denn es wird unterstellt, dass das Geschlecht in einem kontinuierlichen Prozess als „doing gender“ oder als „doing gender while work“ (re)produziert wird (vgl. Gildemeister 2010, 137). Diese (Re)produktion vollzieht sich in zwischenmenschlichen Interaktionen, die alltägliche Erwartungen über die Zuständigkeiten von Geschlechtern realisieren. Da „doing gender“ gezielt als Machtinstrument eingesetzt werden kann, das in der Regel zu einem „doing hierarchy“ mit männlicher Dominanz führt (vgl. Wetterer 2002, 145), sind geschlechtliche Zuordnungen nicht sozial neutral, sondern immer wertend aufgeladen. Sie können deshalb missbräuchlich eingesetzt werden, um ungerechtfertigte soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu „legitimieren“ (vgl. ebd., 121). Gesellschaftliche Macht und Geschlecht sind eng miteinander verknüpft, weil Geschlecht mit ihrem impliziten Hierarchieverständnis nur unter bestimmten Machtbedingungen hervorgebracht wird und diese Macht sich nur durch das normierte reproduzierte Geschlechtsverständnis stabilisiert (vgl. Funk 2018, 111).
Obgleich die vollständige Gleichberechtigung aller Geschlechter sowie das korrespondierende Verbot diskriminierenden Verhaltens aufgrund des Geschlechtes zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Konsens gehören, dürfte kaum jemand ernsthaft bestreiten, dass im alltäglichen Handeln zwischen den Geschlechtern differenziert wird, indem eines der Geschlechter ermutigt wird, bestimmte Handlungen ausführen, während das andere Geschlecht davon abgehalten wird – obgleich beide an Interesse und Talent vergleichbar sind (vgl. Steffens und Ebert 2016, 5).
Im sozialen Alltag treten zwei Widersprüche immer wieder in Erscheinung: Erstens widersprechen die weit verbreiteten Gleichheitsvorstellungen der Handelnden und ihre damit verknüpften normativen Selbstansprüche den tatsächlich gelebten Mustern (vgl. Speck 2019, 67) und zweitens widerspricht ein unterstellter Wandel zu mehr Geschlechtergerechtigkeit der unveränderten traditionellen Geschlechterhierarchien, wie er in der gelebten Geschlechterstereotype verankert ist (vgl. Haines et al. 2016, 6).
1.1 Geschlechterunterschiede
Wie selbstverständlich wird unterstellt, dass es eindeutige, gesicherte und zweifelsfrei nachweisbare Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern gibt, wobei es dahinstehen kann, worauf genau der psychologische oder soziale Unterschied zwischen den Geschlechtern beruht. Allgemein wird vermutet, dass es sowohl biologische Strukturen und Prozesse als auch soziokulturelle Einflüsse sind, die untrennbar interagierend die Ausprägungen bedingen (vgl. Eagly und Wood 2013, 3496).
„Frauen sollen ein System von Eigenschaften haben, Männer ein anderes. Frauen sollen fürsorglich, beeinflussbar, redefreudig, emotional, intuitiv und sexuell treu sein; Männer sollen aggressiv, willensstark, schweigsam, analytisch und promiskuitiv sein.“ (Connell 2013, 90)
Insgesamt wird für Frauen der Gemeinschaftssinn (engl. communality) als prägend angesehen, der sich in Sorge für andere, in Zugehörigkeit, in Ehrerbietung und in gefühlsbetonter Empfindlichkeit äußert (vgl. Heilman 2012, 115). Bei Männern wird als übergeordnetes Merkmal die Handlungsfähigkeit (engl. agency) angeführt, die sich wiederum in Leistungsorientierung, in Rationalität, in einem Hang zur Führung und in Eigenständigkeit differenzieren lässt.
In dieser Untersuchung wird angenommen, dass die Unterschiede der Geschlechter nicht vorgefunden, sondern sozial konstruiert werden. Eine „Frau zu sein“, ist nicht biologisch vorbestimmt, sondern ein ständiger Prozess, bei dem eine Person erst zu einer Frau wird (vgl. Connell 2013, 22). Eine Person konstruiert sich selbst in routinemäßigen Interaktionen als feminin oder maskulin und nimmt auf diese Weise ihren konkreten Platz in der Gesellschaftsordnung ein (vgl. ebd., 23). Ein Geschlecht wird nicht als ein „natürlicher“, biologisch bestimmter Zustand angesehen, sondern als eine soziale Struktur, als ein gesichertes und weit verbreitetes Muster sozialer Beziehungen, in dessen Zentrum eine „reproduktive Arena“ steht (vgl. ebd., 29). Das Geschlecht kann dabei nicht beliebig gewählt werden, sondern ist an eine bestimmte Praxis innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung gebunden. So ist es zum Beispiel in der gegenwärtigen Ordnung leichter, Männer von emotionalen Verpflichtungen zu entbinden und Frauen Bildung und persönliche Freiheiten vorzuenthalten (vgl. ebd., 107).
Ein unreflektiertes zwei-dimensionales Modell, dass nur zwischen Sex und Geschlecht unterscheidet, greift für sich allein zu kurz, weil sich die Geschlechterverhältnisse dezidierter und fruchtbarer analysieren lassen, wenn sie in mehreren Beziehungsdimensionen eingeteilt werden (vgl. ebd., 108ff.). Dazu gehören zunächst die direkten und diskursiv wirkenden Machtbeziehungen zwischen Personen und Institutionen. Des Weiteren sind auf die Produktionsbeziehungen hinzuweisen, die den Konsum und vergeschlechtliche Akkumulation regeln und dabei festlegen, dass Männerarbeit im Bereich entlohnter Arbeit und Produktion im wirtschaftlichen Bereich stattfindet und dass Frauenarbeit zu Hause als unbezahlte Arbeit aus Liebe und gegenseitiger Verpflichtung im Sinne eines Gabentausches erbracht wird (vgl. ebd., 114). Hinzu treten die emotionalen Beziehungen, die sich nicht nur auf die Sexualität beziehen, sondern auch auf die besonderen Beziehungen zur Familie oder Kindern, und dabei Männern eine emotionale Distanz zugestehen (vgl. ebd., 117). Außerdem sind symbolische Beziehungen relevant, die die Repräsentation, Werte und Interpretation der Welt im Interesse bestimmter sozialer Gruppen festlegen und sich in Kultur und Diskurs artikulieren (vgl. ebd., 119).
1.2 Horizontale und vertikale Segregation
Soziale Ungleichheiten sind zwar ein alltägliches Phänomen, sie bedürfen in modernen Gesellschaften aber einer hinreichenden Legitimation, denn die Grundwerte der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Personen untersagen ungerechtfertigte Ungleichheiten.
Einige der sozialen Ungleichheiten basieren darauf, dass das Geschlecht als akzeptierte Bestimmungskategorie dazu verwendet wird, Personen und ihre Handlungen nach bestimmten „geschlechtstypischen“ Merkmalen zu differenzieren und zu bewerten. Dazu werden gesellschaftlich akzeptierte Stereotype über „Frau“ und „Mann“ verwendet (vgl. Krell et al. 2018, 21ff.). Bei Stereotypen handelt es sich um erworbene kognitive Muster, die Einstellungen gegenüber Gegenständen oder Personen zusammenfassen und dadurch handlungsleitende Orientierungen vermitteln (vgl. Steffens und Ebert 2016, 13ff.), ohne dass jedes Mal erneut über komplexe Zusammenhänge nachgedacht werden müsste. Der Gebrauch von Stereotypen ist deshalb bei routinemäßigem Handeln üblich, praktisch hilfreich, zeit- und kostensparend.
Die Anwendung von Geschlechterstereotypen könnte in zwei Situationen zu ungerechtfertigten sozialen Ungleichheiten führen. Erstens wenn überhaupt kein relevanter Unterschied zwischen den Geschlechtern vorliegt, dieser aber dennoch behauptet wird und handlungsleitend werden würde. So ist zum Beispiel äußerst fraglich, ob tatsächlich ein weibliches, personen- und bedürfnisbezogenes Arbeitsvermögen existiert und ein davon unterscheidbares männliches, berufsbezogenes und tauschwertorientiertes Arbeitsvermögen, oder ob es sich dabei nur um eine kontingente soziale Konstruktion handelt (vgl. Teubner 2010, 500), bei der die Geschlechtszugehörigkeit bewusst zu einem relevanten Strukturierungs- und Hierarchieprinzip erhoben wird.
Zweitens wenn tatsächlich ein relevanter Unterschied zwischen den Geschlechtern vorliegt, sich dieser Unterschied aber nicht auswirken und keinesfalls handlungsleitend werden dürfte, weil eine geschlechtliche Differenzierung aufgrund des Verbotes diskriminierender Handlungen nicht zulässig wäre. So könnte eine Arbeitsteilung innerhalb einer Organisation so gestaltet sein, dass bestimmte Arbeitsbereiche oder Tätigkeiten nicht geschlechterneutral zugeordnet werden, sondern „einfache“ Tätigkeiten mehr von Frauen und „höherwertige“ mehr von Männern ausgeführt werden, was konsekutiv zu einer ungerechtfertigten horizontalen Segregation führen würde. „Verstand, Sachlichkeit, Technik und Muskelkraft wurde und wird mit männlichen Tätigkeiten assoziiert, Versorgung, Pflege, Erziehung und feinmotorisches Geschick Frauen zugeordnet.“ (Ehlert 2018, 203).
Würden die Positionen innerhalb der hierarchisch strukturierten Organisation direkt nach dem Geschlecht oder indirekt nach Eigenschaften zugeteilt, die üblicherweise dem Geschlecht zugesprochen werden, dann würde eine ungerechtfertigte vertikale Segregation der Geschlechter entstehen, in der sich die hierarchische Ordnung der Geschlechter in der Organisation spiegelt (vgl. ebd., 199).
1.3 Segregation in der Ärzteschaft
Die Profession „Ärzt*in“1 war historisch ein typischer Männerberuf und das herrschende Geschlechterverhältnis in der Medizin manifestierte sich durch die Teilung in eine männliche Profession und in weibliche zuarbeitende Berufe (Arzthelferinnen und Krankenschwestern) (vgl. ebd., 199). Erst nachdem zu Beginn des 20. Jahrhunderts Frauen zum Medizinstudium zugelassen wurden, entwickelte sich die Profession sehr langsam zu einem Mischberuf. Seit 1960 stieg die absolute Zahl aller berufstätigen Ärzt*innen von 92.806 auf 402.119 im Jahr 2019 und der Anteil der Ärztinnen an der gesamten Ärzteschaft ist mittlerweile kontinuierlich auf 47,6 % gestiegen (Daten der Bundesärztekammer)2, so dass die Medizin einer „Feminisierung“ zu unterliegen scheint.
Mittlerweile beträgt der Anteil der Frauen, die das Medizinstudium erfolgreich abschließen, über 60 % aller Studierenden und die Weiterentwicklung zu einem Frauenberuf (mit ihren negativen Folgen) wäre denkbar. Allerdings ist der medizinische Bereich trotz des zunehmenden Frauenanteils von einer deutlichen horizontalen und vertikalen Geschlechtersegregation geprägt, denn der Frauenanteil verringert sich in höheren Positionen drastisch und ist in den operativen Fachbereichen relativ gering. Selbst in der Frauenheilkunde, die als „weibliche Domäne“ gilt, sind geschlechterspezifische Karriereverläufe weiterhin deutlich nachweisbar (vgl. Hancke et al. 2011, A2148).
Die Zuordnung einer Ärzt*in zu einem bestimmten Fachgebiet ist nicht bereits mit der Berufswahl und dem Beginn des Medizinstudiums gegeben, sondern wird erst am Ende des Studiums und mit der Erteilung der Approbation virulent. Ärzt*innen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend ausgebildet, um sich niederzulassen und Patienten zu behandeln. Die Ärzt*innen sind genötigt, sich beruflich weiterzubilden, indem sie sich einer besonderen Fachrichtung gemäß der gültigen Weiterbildungsordnung (Fachärzt*in) zuwenden oder indem sie als Arzt ohne besondere Gebietsbezeichnung (Ärzt*in) tätig werden. Die Wahl der Fachrichtung ist für den weiteren Berufs- und Karriereweg entscheidend, denn die einmal gewählte Fachrichtung wird sehr selten gewechselt. Die Entscheidung wird deshalb von allen Ärzt*innen äußerst sorgfältig abgewogen und kristallisiert sich meistens bereits im Studium.
Welches Fachgebiet eine junge Ärzt*in für ihre spätere Tätigkeit wählt, hängt von vielen Einflüssen ab, wie die Wahl des Lebensstils, das Prestige und die Besonderheiten einer Fachrichtung, das zu erwartende Einkommen oder die gelebten Stereotype „Ärztin/Arzt“ oder „Mutter/Vater“ bei bestehendem Kinderwunsch. Wer sich zum Beispiel für die Unfallchirurgie mit vielen nächtlichen Bereitschaftsdiensten und ständig wechselnder Belastung entscheidet, der kann sich nicht zugleich für einen geplanten Lebensstil mit deutlicher Trennung zwischen Arbeit und Freizeit entscheiden. So wählen angehende Ärztinnen am Ende des Studiums übereinstimmend über alle Studienorte hinweg bevorzugt die Frauenheilkunde oder Kinderheilkunde und begründen diese Wahl mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ärzte bevorzugen dagegen die operativen Disziplinen und die Innere Medizin (vgl. Gedrose et al. 2011, 1244).
Es sind zwar Daten verfügbar, die die horizontale Segregation der Ärztinnen in Querschnittsuntersuchungen (Gedrose et al. 2011; Hancke et al. 2011; Kuhlmann und Larsen 2012) oder longitudinalen Untersuchungen (Abele und Nitzsche 2002; Buddeberg-Fischer et al. 2008; Ziegler et al. 2017a-c) bestätigen, aber es liegen keine Untersuchungen vor, ob sich die Präferenzen für bestimmte medizinische Fachbereiche über Jahrzehnte hinweg bei einem zunehmendem Anteil an Ärztinnen verändert haben.
Die Datenlage zur vertikalen Segregation der Ärzteschaft ist insgesamt sehr dürftig. Der Anteil an Ärztinnen in höheren Positionen ist weiterhin deutlich geringer als der der Ärzte, mit einer besonderen Männerdomäne in der Chirurgie (vgl. Kuhlmann und Larsen 2012, 226). Die Vorherrschaft der Ärzte scheint so offensichtlich, dass ein Blick auf die Namensschilder der Klinikleitungen eines beliebigen Krankenhauses zur Bestätigung auszureichen scheint.
Obgleich geschlechtsspezifische Ungleichheiten in Organisationen die Regel zu sein scheinen und besonders bei wenig qualifizierten Personen relevant sind, werden Geschlechterdifferenzen in der Ärzteschaft kaum kritisch thematisiert. Mit der Ausnahme, dass immer dann, wenn ein Mangel an qualifizierten Ärzten besteht, die Ärztinnen besonders ermutigt werden, sich den „männlichen Bereichen“ zuzuwenden. Es wäre denkbar, dass die hohe Qualifikation von Ärztinnen automatisch zu einer gleichberechtigten Stellung in der Ärzteschaft führt, aber es wäre genauso gut möglich, dass Geschlechterdifferenzen einfach nur als unerheblich de-thematisiert werden. Aus dieser Gesamtsituation drängte sich das Erkenntnisinteresse auf, ob sich mit zunehmendem Anteil an Ärztinnen die horizontale Segregation, die sich durch ein Ungleichgewicht in der Verteilung der Fachgebiete in „frauenverträgliche“ und „frauenunverträgliche“ Gebiete manifestiert, im Laufe der Zeit auflöst oder fortbesteht. Außerdem wäre von Interesse, ob sich auch die vertikale Segregation verändert oder ob Ärztinnen primär in der Niederlassung tätig werden wollen und keine klinische oder wissenschaftliche Karriere anstreben.
In der Untersuchung wird zunächst danach gefragt, ob eine horizontale oder vertikale Segregation der Ärztinnen in der Ärzteschaft empirisch nachweisbar ist, und wenn das der Fall sein sollte, wird versucht, nach den Gründen für diese Segregation in anderen publizierten Studien zu suchen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich Geschlecht sozial durch ein Wechselspiel zwischen Handeln und Strukturen konstruiert (vgl. Wetterer 2002, 37) und die bisherige Studienlage eine kohärente Interpretation der Daten gestattet.
Dazu werden in einem ersten Schritt (s. Kapitel 2) diejenigen theoretischen Grundlagen skizziert, die zur sachgerechten Erläuterung der Geschlechterdifferenzen in der Ärzteschaft erforderlich sind, wobei die primäre Analyseebene der empirischen Daten die Mikroebene mit den individuellen Entscheidungen der Ärzt*innen ist. Ausgangspunkt der Interpretation ist eine sozialkonstruktivistische Sichtweise, die auf Erkenntnisse von Berger und Luckmann (Berger und Luckmann 1999) aufbaut und dann die Geschlechterdifferenzen in einem Mehrebenenmodell (Makro-, Meso- und Mikroebene) analysiert, um der Komplexität der geschlechtlichen Zusammenhänge gerecht zu werden. Dazu wird auf der Makroebene mit dem soziologischen Institutionalismus unterstellt, dass Geschlecht als Institution die gesamte Gesellschaft und damit auch die Organisationen durchdringt, indem es Deutungs- und Handlungsmuster (über Einstellungen) bereitstellt, dem die Individuen folgen. Auf der Mesoebene werden in Organisationen wichtige transformatorische Funktionen erfüllt, so dass einige Grundgedanken des organisationssoziologischen Neo-Institutionalismus aufgegriffen werden. „Doing gender while doing work“ ist der entscheidende Perspektivenwechsel auf die Familien- und Berufsebene und damit der Schritt mit Fokus auf die Arbeitsteilung und konsekutiv auf die Segregation (vgl. Wetterer 2002, 158f.). Eine handlungsbezogene Fundierung der Geschlechterverhältnisse und -differenzen durch Strukturierungsmechanismen ist auf der Mikroebene unerlässlich, um analysieren zu können, wie Individuen die Institutionen in ihrem Handeln und in Organisationen zugleich produzieren und reproduzieren. Dabei wird das Drei-Säulen-Modell der Institution von Scott (vgl. Scott 2008, 50ff.) erweitert und mit Konzepten der Strukturation von Giddens (Giddens 1988) verknüpft, um Geschlecht in den komplexen Beziehungsdimensionen (vgl. Connell 2013, 108ff.) ausreichend zu würdigen.
In einem zweiten Schritt (s. Kapitel 3) werden die empirischen Daten der Bundesärztekammer Deutschland von 1998 bis 2019 ausgewertet. Zunächst wird überprüft, ob der Anteil der Ärztinnen seit 1998 kontinuierlich zugenommen hat und somit eine „Feminisierung“ der Ärzteschaft feststellbar ist. Danach wird die Geschlechtsverteilung in den verschiedenen Fachbereichen innerhalb dieses Zeitraumes analysiert, um eine ungleiche Verteilung von Ärztinnen in den Fachbereichen als Ausdruck einer horizontalen Segregation nachzuweisen. Als letztes werden alle Fachbereiche im Zeitverlauf daraufhin ausgewertet, ob Ärztinnen häufiger in der Niederlassung tätig sind oder leitende Positionen im Krankenhaus einnehmen. Damit werden das Ausmaß und der Verlauf der vertikalen Segregation in der Ärzteschaft bestimmt. Da es sich bei den Daten um eine valide Vollerhebung der gesamten Ärzteschaft Deutschlands und nicht nur um eine repräsentative Stichprobe handelt, können gesicherte und verlässliche Angaben über die gegenwärtige geschlechtliche Segregation gewonnen werden. Für alle drei Subanalysen werden die verfügbaren publizierten Daten der letzten 20 Jahre ebenfalls ausgewertet und mit den Daten der Bundesärztekammer verglichen.
In einem dritten Schritt (s. Kapitel 4) wird auf allen drei Ebenen (Institution, Organisation, Handlung) untersucht, wie und wodurch die Entscheidungen der Ärzt*innen zugunsten einer bestimmten Tätigkeit durch das Geschlecht beeinflusst werden. Dazu wurden longitudinaler Studien (Befragungen, Interviews) und Querschnittsuntersuchungen (Befragungen) der letzten 20 Jahre zu diesem Themenkomplex eingeschlossen.
Auf der institutionellen Ebene wird zunächst auf die gegenwärtigen Stereotype fokussiert, weil sie in dieser Form für die Ärzt*innen direkt und indirekt handlungsleitend gewesen sind. Auf der organisationalen Ebene ist zusätzlich zu klären, inwieweit Ärzt*innen bei ihrer Wahl durch diskriminierendes Verhalten (lack of fit) oder De-Thematisierungsstrategien im Krankenhaus beeinflusst werden.
Auf der primären Analyseebene, der Handlungsebene, werden in Anlehnung an die Strukturation von Giddens vier strukturierende Perspektiven eingenommen, um den Geschlechtereinflusses auf die Entscheidungen der Ärzt*innen differenziert darzustellen und ausreichend zu würdigen. Es werden die kognitiven Regeln, die normativen Regeln, die Produktionsbeziehungen und die Machtbeziehungen untersucht, um einerseits den komplexen Einfluss des Geschlechtes gerecht zu werden und andererseits ein kohärentes Bild der Zusammenhänge zu präsentieren.
2. Institutionalismus und Strukturation
Eine fruchtbare gedankliche Durchdringung der geschlechtlichen Ungleichheit in der Gesellschaft ist nur möglich, wenn die zu betrachtenden Phänomene auf allen analytischen Ebenen sowie in ihren wechselseitigen Bezügen ausreichend berücksichtigt werden (vgl. Kirchner et al. 2015, 197f.). Damit ist eine Mehrebenen-Analyse (Makro-, Meso- und Mikroebene) unumgänglich und eine alleinige Fokussierung auf Organisationen mit Vernachlässigung der Mikroebene eher hinderlich, wie sie der Neo-Institutionalismus nahelegt (vgl. Funder und Walden 2018, 54ff.).
Der organisationsoziologische Neo-Institutionalismus bietet sich als Forschungsansatz zur Analyse von Geschlechterverhältnissen dennoch an, weil er sowohl soziale als auch kulturelle Einbettungen von Organisationen thematisiert (vgl. Funder 2017, 313). Seine inhärente Abneigung zu einer expliziten Akteursperspektive (vgl. Funder 2017, 320; vgl. Amstutz et al. 2018b, 87) wird in der Studie aber bewusst missachtet und stattdessen wird der Neo-Institutionalismus mit einer Handlungstheorie bzw. dem Strukturationsansatz nach Giddens (Giddens 1988) zu einem Erklärungsmodell verbunden, um eine ausreichende Mikrofundierung im Verständnis der Geschlechterdifferenzen zu gewährleisten.
2.1 Sozialkonstruktivismus
Die Untersuchung basiert auf dem sozialkonstruktivistischen Prinzip, dass uns jede Wirklichkeit als sinnhaft gedeutet erscheint (vgl. Berger und Luckmann 1999, 21).3 Es wird unterstellt, dass sich soziale Strukturen und ein gemeinsames Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit aus Interaktionen von Personen und somit abhängig von einzelnen Individuen entwickeln, indem kohärente Typisierungen kognitiv gebildet und kommuniziert werden, die den Individuen dann als objektiv vorhanden erscheinen, obgleich sie de facto konstruiert worden sind (vgl. ebd., 64). Phänomene werden im sozialen Prozess kognitiv verdinglicht und erscheinen dadurch sinnhaft und objektiv – sie verwirklichen sich. Zur Verwirklichung bedarf es: 1. einer Sprache, um geteilte Bedeutungen zu generieren, 2. der Institutionalisierung, um normative Verbindlichkeit zu erzeugen, 3. der Legitimation, um Sinnkomplexe zu verbinden, und 4. der Sozialisation, um die Objektivationen auf andere Generationen zu transformieren (vgl. ebd., 69ff.; vgl. Miebach 2014, 363).
Eine Institutionalisierung beginnt, indem sich routinisierte Handlungsweisen habitualisieren (vgl. Berger und Luckmann 1999, 56f.), weil sie sich als erfolgreich erwiesen haben, ein bestimmtes gesellschaftliches Problem zu lösen. Dieses habitualisierte Handeln wird zusätzlich typisiert (vgl. ebd., 58f.), damit sich andere Mitglieder der Gesellschaft bewusst darauf beziehen können, so dass im Laufe der Zeit ein Kanon etablierter Handlungsweisen entsteht. Diese Handlungsweisen gelten dann als ausreichend institutionalisiert, wenn andere Personen sie zur Problemlösung anerkennen und sie wie selbstverständlich als gesichert und verlässlich („taken-for-granted“) anwenden.
Da die symbolische Sinnwelt als umfassende „Matrix aller gesellschaftlich objektivierten und subjektiv wirklichen Sinnhaftigkeit“ (ebd., 103) gilt, ordnet sie zugleich alle persönlichen Erfahrungen und legitimiert die institutionelle Ordnung, indem “sie ihrem objektivierten Sinn kognitive Gültigkeit zuschreibt.“ (ebd., 100) Diese Matrix internalisieren die nachfolgenden Generationen durch den Prozess der Sozialisation und übernehmen damit die institutionalisierten Wissensstrukturen und Weltbilder (vgl. ebd., 140f.). Der Sozialkonstruktivismus versucht auf diese Weise zu erklären, wie aus den routinemäßigen Handlungen von Individuen soziale Strukturen (Institutionen) im Sinne von Handlungsmuster werden und wie dieses konstruierte Wissen auf das Handeln wirkt.
2.2 Soziologischer Institutionalismus
2.2.1 Institutionen
Geschlecht wird hier als eine polymorphe Institution (vgl. Eberherr und Hofmann 2018, 44f.) angesehen, die die Handlungen der Individuen maßgeblich beeinflusst. Institutionen sind verbindliche und maßgebliche Regeln, die typische Handlungsmöglichkeiten als dauerhafte Orientierungspunkte sozialen Lebens festlegen und mit Schemata für Handlungen, Erkenntnisse und Emotionen ausstatten (vgl. Lawrence et al. 2011, 53). Für eine Institution ist nicht hinreichend, nur auf einzelne konkrete Handlungen zu verweisen (vgl. Weik 2011, 473), sondern sie besteht aus historisch entwickelten, strukturierten Handlungsanweisungen, die auf gefestigten sozialen Erwartungen beruhen, als objektiv abgesichert gelten und deshalb üblicherweise nicht hinterfragt werden (vgl. Funder und May 2014, 200). Sie erschaffen auf diese Weise eine gesellschaftliche Ordnung und artikulieren auch Machtverhältnisse (vgl. Eberherr und Hofmann 2018, 45), denn wer sich nicht an die gesetzte Erwartungshaltung einer Institution hält und stattdessen anders handelt, muss damit rechnen, nicht auf Zustimmung zu stoßen und dafür einen entsprechenden „Preis“ zu zahlen (vgl. Schmid 2018, 16).
Diese oder ähnlich plausible Definitionen von Institutionen haben den Nachteil, dass die verwendeten Begriffe sehr ungenau bestimmt sind und somit unter eine Institution fast alles subsumiert werden könnte. Diese Schwäche kann nicht durch einen raschen und unbekümmerten Wechsel zwischen Metaphern kompensiert werden (vgl. Alvesson et al. 2019, 211), sondern nur durch „schärfere“ Begriffe. In der Untersuchung wird deshalb dem Drei-Säulen-Modell der Institution von Scott gefolgt (vgl. Scott 2008, 50ff.) und unter einer Institution eine soziale Struktur verstanden, die Regeln vorschreibt, die sich aus drei verschiedenen Regelarten konstituieren: regulativen, normativen und kulturell-kognitiven Regeln.
Die Grundstruktur der regulativen Regeln basiert auf Verordnungen, Gesetze oder auch informellen Formen, denen aufgrund von Zweckmäßigkeit zwingend gefolgt wird, die soziales Handeln regulieren, die einer instrumentellen Logik folgen und bei Nichtbeachtung gesetzlich sanktioniert werden. Das Fundament der normativen Regeln sind dagegen Normen und Werte, die auf einer sozialen Verpflichtung beruhen, internalisierte und bindende Erwartungen ausdrücken, häufig unbewusst in Routinen umgesetzt werden, die einer Logik der Angemessenheit folgen und die bei Nichtbeachtung als moralisch beschämend angesehen werden. Die kulturell-kognitiven Regeln bauen auf konstitutive Schemata auf, die einem sozial geteilten Verstehen folgen, als kulturell verankert und gesichert gelten, den Rahmen einer Situation bestimmen (vgl. Wilkesmann 2009, 145), einer Logik des Vertrauens folgen, auf unhinterfragte, selbstverständliche Annahmen über durchzuführende Handlungen beruhen und bei Nichtbeachtung zu Konfusion und Unverständnis führen (vgl. Scott 2008, 51).
Obgleich die Regeln konzeptionell unterschieden werden, sind sie allesamt in unterschiedlichem Ausmaß in jeder Institution präsent und nur analytisch eindeutig trennbar (vgl. Nagel et al. 2017, 156). Häufig ist eine Regel leitend, wobei letztlich alle Aspekte kulturell-kognitiv in Form von Wissen verankert sein müssen.
2.2.2 Einstellungen
Einstellungen sind Bewertungen über andere Personen oder Gruppen und werden analytisch in Vorurteile (affektiv), Stereotype (kognitiv) und Diskriminierungen (effektiv) differenziert (vgl. Steffens und Ebert 2016, 14).
Vorurteile sind mit Gefühlen als affektive Komponente verbunden, drücken als Urteile negative oder positive Bewertungen von Personen aus (vgl. Förster 2009, 23) und führen entweder zu einer allgemeinen abwertenden, herabsetzenden Haltung gegenüber Personen (vgl. Krell et al. 2018, 23) oder zu einer Bevorzugung der eigenen Gruppe.
Bei Stereotypen handelt es sich um kognitiv verankerte Beschreibungen von Personen oder Gruppen, die besonders einfach und einprägsam sind und durch relevante Merkmale (wie soziale Rollen und Positionen, physische oder psychische Eigenschaften, Interessen) vereinfachend charakterisiert und kategorisiert werden (vgl. Steffens und Ebert 2016, 14; vgl. Krell et al. 2018, 21).
Stereotype sind sehr nützlich, weil sie im sozialen Alltag helfen, Personen aufgrund äußerer Merkmale rasch und „verlässlich“ einer Gruppe zuzuordnen, mit der bestimmte Verhaltenserwartungen verknüpft werden. Nachteilig ist diese automatische vereinfachende Zuordnung (vgl. Heilman 2012, 115), wenn mit ihr zugleich ungerechtfertigte soziale Ungleichheiten entstehen oder fixiert werden. So wird zum Beispiel eine geschlechtliche Segregation bei der Feuerwehr mit hegemonialer Männlichkeit erklärt, weil es besonderen Mutes oder einer gewissen erforderlichen Körperkraft bedarf, um ein „guter“ Feuerwehrmann zu sein (vgl. Horwath 2017, 126).
Die Geschlechterstereotypen als sozial anerkannte Überzeugungen sind interkulturell sehr ähnlich (vgl. Williams et al. 1999, 519f.) und die Einschätzung von Geschlechterunterschieden von unterschiedlichen Personen offenbart eher eine Unterschätzung von Unterschieden als eine Überschätzung (vgl. Swim 1994, 32). Frauen werden fast überall als fürsorglich, einfühlsam und verständnisvoll und Männer als selbstbewusst, unabhängig und konkurrierend beschrieben (vgl. Steffens und Ebert 2016, 14).
Neben ihrer deskriptiven Funktion zur Kategorisierung fungieren Stereotype auch normativ zur Rechtfertigung von Geschlechterdifferenzen, indem sie festlegen, wie sich Personen zu verhalten haben (vgl. ebd., 18). Männer sollten bestimmend, konsequent, dynamisch und eigenständig auftreten, um männlich zu sein. Frauen sollten dagegen hilfsbereit, sympathisch, liebenswürdig und sorgend auftreten, um weiblich zu sein.
Verletzt jemand das beschreibende Stereotyp so werden andere Personen durch die unerwarteten Verhaltensweisen lediglich irritiert. Werden dagegen vorschreibende Inhalte des Stereotyps nicht eingehalten, dann werden die Verhaltensweisen missbilligt. Wenn wesentliche Eigenschaften bei einer Person fehlen oder gar solche des anderen Geschlechtes nachweisbar sind und damit das Stereotyp verletzt wird, dann wird die Person meistens nicht gemocht, benachteiligt und im weiteren Fortkommen beeinträchtigt (vgl. Heilman 2001, 666f.).
Unter Diskriminierungen werden Handlungen verstanden, die auf Stereotype und Vorurteilen basieren und Personen entweder bevorzugen oder benachteiligen (vgl. Förster 2009, 25). Diskriminierungsverbote beruhen primär auf einem Differenzierungsverbot aufgrund formeller, normativer Gleichheit und weniger auf einem Dominierungsverbot aufgrund materieller Ungleichheit (vgl. Krell et al. 2018, 14).
Alle Einstellungen über den Unterschied oder die Gleichheit der Geschlechter wirken sich direkt oder indirekt auf Interessen und Präferenzen als auch auf Entscheidungen des Individuums zugunsten einer Handlung aus und sind deshalb beachtlich.
2.3 Organisationssoziologischer Neo-Institutionalismus
Aus einer neo-institutionalistischen Perspektive prägen Institutionen die Organisationen, weil sie immer in gesellschaftliche Institutionen eingebettet sind und durch Werte, Normen und Kultur beeinflusst werden (vgl. Funder und May 2014, 198). „Organisationen sind von ihrer Umwelt abgrenzbare soziale Gebilde, die über eine angebbare Anzahl an Mitgliedern verfügen und deren Interaktionen und Beziehungen arbeitsteilig auf die Erreichung eines definierten Ziels hin ausgerichtet sind.“ (Wilz 2010, 514) Sie bilden ein soziales System aus einem Geflecht aus Handlungen und konstituieren eine Struktur, die formelle und informelle Regeln setzt und dadurch Handlungsweisen institutionalisiert (vgl. Wilz 2015, 265).
Organisationen bedürfen Ressourcen, die sie aber nur erhalten, wenn sie gesellschaftlich legitimiert wurden (vgl. Ranftl 2017, 195) und sich nach verbindlichen Verordnungen, Normen und Werten richten (vgl. Funder und Walden 2018, 38f.). Manchmal werden dazu Rationalitätsfassaden aufgebaut, die darüber täuschen sollen, dass die gesellschaftlichen Erwartungen eigentlich nicht erfüllt werden, die zur Legitimation erforderlich sind. So ist die Entkoppelung von erwarteten Strukturen (formal erforderlich) und effizienten Strukturen (tatsächlich produktiv) eine geübte Strategie, wenn widersprüchliche Anforderungen an eine Organisation gestellt werden (vgl. Funder und May 2014, 206).
Mit dem Blick auf die Mesoebene der Organisation wird deutlich, wie in den Organisationen Geschlecht gezielt als Ressource eingesetzt werden kann, um Hierarchien und unfaire Arbeitsteilungen zu rechtfertigen (vgl. Wetterer 2002, 524). Gerade Organisationen, deren Effektivität und Effizienz auf formellen und informellen Regeln beruhen und die hierarchisch strukturiert sind, scheinen besonders geeignet zu sein, um ungerechtfertigte Handlungsmuster zu institutionalisieren (vgl. Rybnikova und Lang 2017, 241) und auch gegen Veränderungen zu schützen.
Obgleich Organisationen Hierarchisierungen gezielt schaffen und im Detail festlegen, unter welchen konkreten Bedingungen gearbeitet werden soll (vgl. Wilz 2010, 514), ist keinesfalls als selbstverständlich zu unterstellen, dass die Geschlechterfrage in Organisationen tatsächlich relevant ist. Denn es scheint vielmehr vom Kontext abzuhängen, ob Geschlechterunterschiede virulent werden oder nicht (vgl. Wilz 2013, 152). Organisationen könnten aus abstrakter Perspektive als geschlechtsneutral angesehen werden und damit als weder von Personen noch von gesellschaftlichen Strukturen abhängig (vgl. ebd., 155). Aus konkreter Perspektive mit Blick auf Personen und nicht nur auf Stelleninhabern könnte das Geschlecht dagegen als konstitutives Element der Prozesse in der Organisation aufgefasst werden, die die Ungerechtigkeit fördert (vgl. Acker 1990, 147).
Selbst wenn eine Geschlechterdifferenz für eine Organisation oder einen Prozess nicht immer relevant zu sein scheint, können Geschlechterfragen auf allen Ebenen bedeutsam werden (vgl. Wilz 2013, 156), denn in fast allen Organisationen herrschen unterschiedliche Möglichkeiten zur Macht- und Einflussgewinnung, zur sozialen Absicherung und zur Beeinflussung von Löhnen und Arbeitsbedingungen. Allerdings ist empirisch zu prüfen, ob Segregationen durch interne Faktoren wie einer gezielte Organisationsgestaltung oder informelle Wirkungen entstehen oder ob für den Effekt eher externe Einflussgrößen der Umwelt wie der Arbeitsmarkt verantwortlich sind.
2.4 Strukturationstheorie
2.4.1 Handeln und Handlung
Da die Handlungsebene der Individuen die primäre Analyseebene ist, wird eine geeignete Handlungstheorie benötigt. Die Frame-Selektions-Theorie (vgl. Esser 2018, 14ff.) wäre dazu durchaus angemessen gewesen, aber sie ist durch ihre Nähe zur rationalen Entscheidungstheorie weniger geeignet und bezüglich des Institutionalismus weniger gut anschlussfähig. Die Strukturationstheorie von Giddens (Giddens 1988) ist dagegen aufgrund ihrer wechselseitigen Konzeption zwischen Handlung und Struktur aussichtsreicher, die Zusammenhänge fruchtbar zu erläutern.
Handeln verändert etwas und drückt dadurch eine Macht aus, etwas gestalten zu können (vgl. ebd., 66). Handeln ist an ein intentional agierendes Individuum gebunden, das über die erforderliche Kompetenz sowie ausreichendes theoretisches und praktisches Vermögen verfügen muss (vgl. ebd., 36). Jede Form des zielorientierten, absichtsgeleiteten Handelns erfordert vom Handelnden eine Entscheidung, zwischen verschiedenen Handlungsweisen wählen zu müssen (vgl. Schmid 2018, 11). Deshalb wird bei absichtlichem Handeln ein autonomes Subjekt unterstellt, das bewusst entscheiden kann.
Handeln besteht nicht aus einer Akkumulation von ontologisch einzelnen Handlungen, sondern aus einem kontinuierlichen Strom des Handelns, der erst im Nachhinein temporal strukturiert wird (vgl. Leschziner 2013, 135). Was beim Handeln als eine Handlung gilt und was als eine andere, das principium individuationis, basiert auf einem reflexiven Prozess des Handelnden oder einer anderen Person. Erst im Nachhinein lässt sich ein Teil des Handlungsstroms individualisieren und die Frage stellen, ob die so festgelegte Handlung als automatisch oder absichtlich ausgeführt wurde und welche guten Gründe dafür angeführt werden können (vgl. Giddens 1988, 53f.).
Wenn jemand absichtlich handelt, um ein Ziel zu erreichen, dann treten sowohl beabsichtigte als auch unbeabsichtigte Konsequenzen auf oder solche, die sich erst sehr viel später zeigen (vgl. ebd., 61ff.). Deshalb ist es üblich, Handlung und Intention des Handelnden zu differenzieren, indem dasjenige, was tatsächlich getan wird, vom Beabsichtigten unterschieden wird (vgl. Frommann 2014, 45).
Handlungen können sich vielfältig auswirken: sie können erfolgreich sein oder nicht, sie können radikal verändern oder bewahren, sie sind manchmal strategisch wohlüberlegt, vollständig routinemäßig oder massiv emotional aufgeladen, sie können das Resultat ausgehandelter Kompromisse oder machtvoller Einzelentscheidungen sein, und unbeabsichtigte schwere und dauernde Konsequenzen haben.
Was Handlungen auszeichnet, ist ihre Intentionalität und ihre Anstrengung, etwas zu erreichen (vgl. Emirbayer und Mische 1998, 973). Sie sind auf Zukünftiges gerichtet und können dabei auf bewusste Veränderungen oder auf die automatische und habituelle Bewältigung von Situationen gerichtet sein. Handeln ist eingebettet in einen biographischen, situativen und interaktiven Handlungszusammenhang und wird als zeitlich konstruierte Auseinandersetzung eines Handelnden mit seiner strukturierten Umwelt verstanden, so dass sich immer ein zeitlicher und relationaler Kontext einer Handlung nachweisen lässt (vgl. ebd., 970).
Die Handelnden legen ihrer Handlung einen subjektiven Sinn bei, wobei es zum Verständnis der Handlung nicht ausreicht, nur diesen subjektiven Sinn zu verstehen. Der Begriff „Handlung“ wird nicht auf den interpretativen Kontext eingeschränkt, sondern jede Handlung wird immer von einem Akteur unter bestimmten Rahmenbedingungen und durch Gebrauch bestimmter Ressourcen ausgeführt, die den Akteur einerseits einschränken und andererseits in seinen Handlungsmöglichkeiten durch geeignete Instrumente oder Techniken erweitern.
2.4.2 Dual-Prozess-Modelle
Jede Handlung enthält einen automatischen bzw. routinemäßigen und einen vollständig durchdachten bzw. absichtlichen Anteil, die analytisch in zwei Idealtypen trennbar sind. Die automatisch ausgeführten Handlungen überwiegen im Alltag bei weitem. Sie haben sich im Laufe der Zeit als erfolgreiche Routinen herausgebildet, stabilisieren die soziale Ordnung und entlasten Personen von erneuten Entscheidungen. Diese Routinen werden in der Regel unbemerkt bzw. unbewusst getätigt, aber sie können die Aufmerksamkeit des Handelnden auf sich ziehen, wenn sie nicht zum Erfolg führen, so dass sich ein Handelnder bewusst und reflektierend mit dem unbewältigten Problem auseinandersetzt.
Fraglich ist, wie „unbewusste“ Handlungen und absichtliche Handlungen dennoch vereint konzipiert werden können. Dazu eignen sich Dual-Prozess-Modelle. Die Dual-Prozess-Modelle formulieren einen allgemeinen kognitiven Rahmen, der dichotom von zwei Typen der Erkenntnisse, des Lernens und des Gedächtnisses begrenzt wird (vgl. Lizardo et al. 2016, 289). Der Typ I ist praktisch, verkörpert, implizit, langsam erlernbar, prozedural, assoziativ, impulsiv und automatisch, während der Typ II konzeptuell, symbolisch, explizit, schnell erlernbar, deklarativ, regel-basiert, reflexiv und kontrolliert ist (vgl. ebd., 294). Das Gedächtnis kann dementsprechend idealtypisch in ein explizites bzw. deklaratives (Typ II) und ein implizites bzw. prozedurales Gedächtnis (Typ I) eingeteilt werden. Das deklarative Gedächtnis erfordert eine bewusste Erinnerung als semantisches oder episodisches Gedächtnis. Das prozedurale Gedächtnis umfasst dagegen praktisches Wissen, Priming, Konditionierung und Formen des nicht-assoziativen Lernens (vgl. Vila-Henniger 2014, 240).
Im soziologischen Kontext wird die dichotome Unterscheidung der beiden Typen häufig (fahrlässig) verwendet, um den Wechsel von sozialen Rollen oder den praktischen Vollzug von unterschiedlichen kontextuellen Anforderungen begrifflich zu erfassen. So werden zum Beispiel Handlungen als eher automatisch gemäß Typ I oder als mehr absichtlich gemäß Typ II klassifiziert und mit deren Merkmalen verbunden (vgl. Leschziner 2018, 10). Beide Typen arbeiten aber nicht exklusiv, sondern parallel miteinander (vgl. Lizardo et al. 2016, 296; vgl. Leschziner 2018, 3), wobei Beweggründe für Handlungen fast immer bewusst sind, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß (vgl. Leschziner 2018, 9).4 Für die Strukturierung von Handlungen eignen sich nicht nur die beiden Extreme einer quasi automatischen und einer reflektierten absichtlichen Handlung, sondern es ist das gesamte Kontinuum zwischen beiden Extremen verfügbar.
Die Dual-Prozess-Modelle beanspruchen für sich, den Prozess der Enkulturation dadurch zu erklären, dass kulturelle Muster durch Lernen internalisiert werden und sich dann auf Handlungen und Erkenntnisse auswirken (s. Kap. 2.1). Internalisierung wird somit als Enkodierung kulturellen Wissens in das Langzeitgedächtnis interpretiert (vgl. Lizardo et al. 2016, 292). Das Erwerben einer Gewohnheit basiert immer auf beiden Arten des Gedächtnisses (vgl. Vila-Henniger 2014, 240). Aus dem prozeduralen Gedächtnis entwickeln sich zwar Dispositionen, Präferenzen oder Gewohnheiten, aber erst durch deklaratives Wissen wird es für uns verfügbar – und kann in Interviews5 zur Kenntnis gebracht werden (vgl. ebd., 254).
Mit dem Dual-Prozess-Modell ist somit gut erklärbar, wie erlernte Stereotype (als Institutionen) die Präferenzen und Gewohnheiten der Individuen prägen.
2.4.3 „Institutional Entrepeneurship“ und „Institutional Work“
Da Institutionen auch gestaltbar sind (vgl. Kirchner et al. 2015, 196), entsteht das „Paradox des eingebetteten Handelns“ im Institutionalismus: Einerseits akzeptiert ein Handelnder eine Institution als gesichert und lässt keine Alternativen zu und andererseits verändern sich Institutionen durch Handeln (vgl. Weik 2011, 46; vgl. Rybnikova und Lang 2017, 247).
Veränderungen oder sogar eine neue Form einer Institution zu bewirken, ist aus einer institutionellen Perspektive kaum zu begründen, ohne auf die gezielten Eingriffe von Handelnden zurückzugreifen (vgl. Hwang und Colyvas 2011, 62; vgl. Tracey et al. 2011, 62). Dazu wurden die Modelle eines „Institutional Entrepeneurs“ oder der „Institutional Work“ entwickelt, die beide ein autonom handelndes Subjekt unterstellen, das über die erforderliche Macht verfügt, Institutionen zu verändern (vgl. Amstutz et al. 2018b, 96).6 Die zu bewirkenden Effekte beruhen manchmal nicht allein auf dem zielgerichteten Handeln einzelner Personen, sondern sie könnten auch von vielen Handelnden zugleich verursacht worden sein oder es könnten sich auch um nicht-intendierte Konsequenzen von „unbeteiligten“ Handelnden oder um unerwartet Folgen nicht-linearer Prozesse handeln (vgl. Lawrence et al. 2011, 55).
Von einem „institutionellen Entrepeneur“ wird erwartet, dass der Handelnde gezielt auf die Veränderung der Institution einwirkt (vgl. Beunen und Patterson 2019, 19) und dabei seine Macht strategisch und mikropolitisch sinnvoll einsetzt (vgl. Weik 2011, 466). Um als Entrepeneur eine neue institutionelle Form zu etablieren, sind Erneuerungen auf allen drei analytischen Ebenen anzuregen. Auf der Mikroeben müsste der Entrepeneur eine Gelegenheit erkennen, ein Problem unter neuen Gesichtspunkten zu rahmen und dafür eine neue Lösung anzubieten. Auf der Mesoebene müsste der Entrepeneur dann eine organisationale Vorlage entwickeln und theoretisch begründen, warum gerade sie zur Lösung geeignet ist. Auf der Makroebene müsste die neue Form durch geeignete Diskurse und in Übereinstimmung mit den verantwortlichen (machtvollen) Akteuren legitimiert werden (vgl. Tracey et al 2011, 61). Bei diesem Vorgehen sind unbedingt die vorhandenen Logiken (Machtstrukturen, Symbole, Sprache) einer spezifischen Institution zu berücksichtigen, denn sonst würde die Legitimation der Erneuerung scheitern und bliebe erfolglos (vgl. ebd., 62).
„Institutional Work“ ist definiert als zielgerichtete Handlung von Individuen und Organisationen, um Institutionen zu entwickeln, zu erhalten oder zu zerstören (vgl. Lawrence et al. 2013, 1024). Mit ihr wird versucht, die aktive Rolle der Individuen zu betonen (vgl. Rybnikova und Lang 2017, 249), die zur Neuentwicklung, zum Erhalt und für Veränderungen von Institutionen maßgeblich sind (vgl. Lawrence et al. 2011, 53f.), wobei sie sich explizit auf Berger und Luckmann beziehen, aber zusätzlich noch eine biographische Perspektive der Individuen empfehlen.
Bisher ist das Handlungsverständnis beider Ansätze wenig ergiebig, weil es die Beschränkungen durch materielle Gegebenheiten (Ressourcen, Instrumente) oder moralische Bindungen oder verantwortliche Entscheidungen unberücksichtigt lässt (vgl. Lawrence et al. 2013, 102f.), so dass in der vorliegenden Untersuchung auf die Strukturationstheorie von Giddens Bezug genommen wird.
2.4.4 Strukturierung und Kontextualisierung
Die Strukturationstheorie, wie sie Anthony Giddens ursprünglich formulierte (Giddens 1988), wird nicht in nuce übernommen, sondern nur insoweit sie die Rekursivität von Handeln und Struktur und die analytisch entwickelten Formen der Reproduktion betont. Ansonsten wird sie an genannten Entwicklungen der kognitiven Psychologie und den Neo-Institutionalismus adaptiert.
Soziale Systeme bestehen aus wiederkehrenden Handlungen, in denen sich Handelnde aufeinander beziehen (vgl. Giddens 1988, 38f.; vgl. Frommann 2014, 30). Handlungen und Strukturen, die die soziale Ordnung festlegen, beziehen sich ständig rekursiv aufeinander (vgl. Giddens 1988, 52), so dass Handlungen direkt von Strukturen abhängen und sich Strukturen erst durch Handlungen konstituieren (vgl. ebd., 70). Beide sind nur analytisch trennbar, indem entweder Handlung oder Struktur als unveränderlich gedacht wird (ceteris paribus) und dann die andere Seite moduliert wird (vgl. ebd., 83).
Es handelt sich bei einer Struktur um ein Moment der institutionellen Ordnung und zugleich um eine Vermittlungsebene, zwischen Handlung und gesellschaftlicher Institution. Gerade die Vermittlungsebene zwischen Struktur und Handlung, die die sogenannten Modalitäten (interpretatives Schema, Fazilität, Norm) (vgl. ebd., 81) enthalten, ist von besonderem Interesse, denn gerade diese Modalitäten werden von kompetenten Akteuren unterschiedlich beachtet. Von der Strukturseite gesehen, sind die Modalitäten Anwendungsformen der Struktur und kontextualisieren. Von der Seite des konkreten Handelns gesehen, sind die Modalitäten als verallgemeinernde Typisierungen zu betrachten, die durch Abstraktion entstehen und strukturieren (vgl. Frommann 2014, 69).
Der rekursive Prozess besteht somit aus den beiden Teilen der Strukturierung und der Kontextualisierung. Handlungen strukturieren (Herrschaft- oder Wissensstrukturen) und Strukturen kontextualisieren, indem sie die Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Ordnung vorgeben und dabei bewusst oder unbewusst von den Handelnden passend zur Situation angewendet werden (vgl. ebd., 64). Während Handeln kontextgebunden und indexikal ist, sind Strukturen aufgrund von Abstraktionen kontextfrei und nicht indexikal (vgl. Hauptmann 2012, 75).
Strukturen bestehen aus konstitutiven und regulativen Regeln sowie allokativen und autoritativen Ressourcen (vgl. Giddens 1988, 45). Konstitutive Regeln wirken institutionell als Weltbilder und als symbolische Ordnungen. Sie gelten als Deutungsschema und schaffen Bedeutungen, die als Sinn kommuniziert (vermittelt) werden. Im Gegensatz dazu schaffen regulative Regeln eine legitime Ordnung mit rechtlichen Institutionen, die auf moralischen Prinzipien basieren und dadurch Sitte, Gebräuche, Gesetze und Verordnungen festlegen. Diese Regularien werden durch moralische Bindungen, Erziehung, Sozialisation und Sanktionen im sozialen Handeln vermittelt (vgl. ebd., 81f.).
Ressourcen statten Personen mit den erforderlichen (Macht)Mitteln aus, um Handlungen gestaltend zu ermöglichen. Von Ressourcen wird dann gesprochen, wenn sie Handlungsmöglichkeiten schaffen oder erweitern, die ohne die Ressourcen nicht verfügbar wären.
Allokative Ressourcen wie Geldmittel, Rohstoffe, Techniken können in Abhängigkeit von ökonomischen und sonstigen materiellen Abhängigkeiten nur mobilisiert werden, wenn die dafür zuständigen Institutionen zustimmen. Autoritative Ressourcen wie Planungsinstrumente, Arbeitsorganisation, Verwaltungsapparate werden in Abhängigkeit von der politischen Herrschaftsordnung mobilisiert und vermitteln die erforderliche Macht über andere Personen.
3. Empirische Analyse der Ärzteschaft
In der Studie soll durch eine Sekundäranalyse empirisch überprüft werden, ob die zunehmende Feminisierung der Ärzteschaft in den letzten Jahrzehnten auch dazu führte, dass sich die Verteilung der Geschlechter in der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und den leitenden stationären Positionen in den einzelnen Fachrichtungen änderte. Es werden die beiden Hypothesen aufgestellt, dass sich trotz der Feminisierung die relativen Anteile der Ärztinnen in den einzelnen Fachgebieten nicht geändert haben (horizontale Segregation) und dass der relative Anteil der Ärztinnen in leitenden Positionen (vertikale Segregation) nicht zugenommen hat.
3.1 Methode
3.1.1 Daten der Bundesärztekammer
Jede Person, die zur Ausübung der Heilkunde zugelassen ist (Approbation), ist Zwangsmitglied der zuständigen Landesärztekammer, die jährlich den aktuellen Status der Mitglieder im Sinne einer Vollerhebung erfragt, so dass die erhobenen Daten der Landesärztekammern als valide und verlässlich gelten. Sie werden von der Bundesärztekammer über alle Bundesländer hinweg aggregiert und als „Ärztestatistik“ jährlich veröffentlicht.7 Sie sind die Basis für die vorliegende Sekundäranalyse.
Die veröffentlichten Daten der Bundesärztekammer von 1998 bis 2019 wurden nicht jährlich, sondern in jeweils drei Jahresabständen ausgewertet, weil sehr kurzfristige Veränderungen äußerst unwahrscheinlich sind. Die Daten der Bundesärztekammer sind in Tabellen aufgeführt, die die absolute Anzahl der gesamten berufstätigen Ärzt*innen (als Tabelle 3 der Statistik der Bundesärztekammer) und die der Ärztinnen (als Tabelle 4 der Statistik der Bundesärztekammer) für alle genannten Fachbereiche enthalten. In den Tabellen sind die Merkmale gesondert aufgeführt, ob die Ärzt*innen im ambulanten oder stationären Bereich tätig sind und ob sie im stationären Bereich eine leitende Funktion einnehmen.
Von allen berufstätigen Ärzten wurden nur diejenigen ausgewählt, die in speziellen Fachbereichen (außer Allgemeinmedizin) beschäftigt waren, die mit der unmittelbaren Patientenversorgung betraut sind (klinische Fächer) und deren Anzahl im Jahr 2019 mindestens 5000 Ärzte im Fachgebiet betrug. Ausgeschlossen wurden zum Beispiel die Fachbereiche: Anatomie, Gerichtsmedizin oder Laboratoriumsmedizin, die allesamt weniger als 5 Prozent aller Ärzt*innen umfassten. Insgesamt wurden 12 klinische Fachbereiche ausgewählt: Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren-(HNO)-Heilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin (Kinderheilkunde), Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Radiologie und Urologie.
3.1.2 Bearbeitung und Analyse
Da sich während des Untersuchungszeitraumes die Weiterbildungsordnungen der Ärztekammern geändert hatten, wurden die Fachgebiete „Nervenheilkunde“ und „Neurologie“ unter Letzterem zusammengefasst; die operativen Fächer „Chirurgie“ und „Orthopädie“ wurden unter „Chirurgie“ subsumiert, weil die Orthopädie mit der Unfallchirurgie „fusionierte“ und die Unfallchirurgie als Teil der Chirurgie in die Auswertung einging; die „Diagnostische Radiologie“ wurde zur „Radiologie“ gezählt; und die „Psychiatrie und Psychotherapie“ wurden zur „Psychiatrie“ hinzugefügt.
Es wurden zunächst die absoluten Werte analysiert und der Anteil der Ärzte durch Differenz berechnet. Danach wurden die relativen Geschlechtsanteile für die einzelnen 12 Fachbereiche für jedes untersuchte Jahr berechnet. Eine Segregation in Abhängigkeit vom Fachgebiet zeichnet sich dadurch aus, dass die Anteile der Geschlechter innerhalb eines Fachbereichs anders verteilt sind als in der Grundgesamt der Ärzteschaft. Eine Segregation würde also nicht vorliegen, wenn sich in jedem Fachgebiet derselbe Anteil an Ärztinnen nachweisen ließ.
Alle Daten wurden chronologisch abgebildet, so dass eine Übersicht der präferierten Fachbereiche der Geschlechter im Zeitverlauf gewonnen werden kann. Die gesamte Auswertung einschließlich der graphischen Darstellung wurde mit der Software SPSS (Version 21) vorgenommen.
3.2 Ergebnisse
3.2.1 Verteilung der Geschlechter in der Ärzteschaft
Die Zahl aller berufstätigen Ärzt*innen hat sich kontinuierlich von 92.806 im Jahr 1960, auf 287.032 im Jahr 1998 (Untersuchungsbeginn) und auf 402.119 im Jahr 2019 (Untersuchungsende) vervierfacht. Im Jahr 1998 betrug der weibliche Anteil mit 104.490 Ärztinnen nur 36,4 %, im Jahr 2009 bereits 42,2 % und im Jahr 2019 47,6 % in der gesamten berufstätigen Ärzteschaft.
Die Zahl der ambulant- und stationär-tätigen Ärzt*innen der Untersuchungspopulation nahm kontinuierlich zu, während die Zahl der leitenden Positionen im Untersuchungsintervall nur unwesentlich von 11.703 auf 14.066 anstieg (Abb. 1). Der Anteil der leitenden Tätigkeiten im Krankenhaus nahm insgesamt von 19,8 % auf 13,6 % ab.
Die absolute Zunahme an beschäftigten Ärzt*innen ging zusätzlich mit einem erhöhten Anteil an Ärztinnen einher. Sowohl im ambulanten (von 29,5 % auf 42,9 %) als auch im stationären Bereich (von 27,0 % auf 40,6 %) stieg der weibliche Anteil kontinuierlich und deutlich an (Abb. 2). Der weibliche Anteil leitender Positionen erhöhte sich nicht gleichermaßen, sondern nur mäßig von 8,5 % auf 13,0 %.
3.2.2 Ambulante und stationäre Segregation der Ärzteschaft
In allen Fachgebieten stieg die Zahl der ambulant-tätigen Ärzt*innen im Untersuchungszeitraum geringgradig an, wobei sie in der Inneren Medizin und der Psychiatrie am stärksten zunahm (Abb. 3).
Der Anteil der ambulant-tätigen Ärztinnen unterschied sich deutlich zwischen den Fachgebieten als Ausdruck einer Segregation innerhalb der Fachgebiete (Abb. 4), denn der Anteil müsste bei einer Gleichverteilung der Geschlechter den Durchschnittswerten in Abbildung 2 entsprechen. Der Anteil stieg in allen Fachgebieten kontinuierlich an, weil alle Gebiete zunehmend von Ärztinnen besetzt wurden. Da die meisten Kurven parallel zueinander verlaufen, haben sich die Präferenzen der Ärztinnen für die Fächer nicht geändert. Lediglich in der Gynäkologie wurden Ärztinnen häufiger und in der Anästhesie seltener ambulant tätig.
Im stationären Bereich stieg die Zahl der Ärzt*innen ebenfalls kontinuierlich an, wobei der Anstieg besonders stark in den großen Fachgebieten (Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie) war (Abb. 5).
In den kleineren Fachbereichen war eine Zunahme der Psychiatrie/Psychotherapie auffällig. Im stationären Fachbereich findet sich eine ausgeprägte Segregation (Abb. 6). Die großen Fachgebiete wie Innere Medizin und besonders die Chirurgie wurden gemieden, während die kleineren Fachgebiete bevorzugt wurden. Die Kurven verlaufen weitgehend parallel, so dass sich die Präferenzen zwischen den Fachgebieten kaum geändert haben. Die Anästhesie hat an Attraktivität verloren, weil sie keinen Anstieg wie alle anderen Fachgebiete zeigt. Besonders präferiert wurde die Gynäkologie, deren Anteil von 35,4 % auf 67,1 % sehr stark zunahm.
3.2.3 Vertikale Segregation der Ärzteschaft
Die Anzahl der leitenden Positionen nahm nur in den großen Fachgebieten der Inneren Medizin und Chirurgie zu, weil sich durch die kontinuierliche Spezialisierung einige Subdisziplinen abspalteten und dadurch zusätzlich leitende Positionen erforderlich wurden (Abb. 7). In den anderen Fachgebieten waren die leitenden Positionen weitgehend konstant, weil sich die Anzahl der Kliniken nicht änderte.
Die Besetzung leitender Positionen mit Ärztinnen entspricht in keinem Fachgebiet dem relativen Anteil der stationär-tätigen Ärztinnen (Abb. 8). Zwischen den Fachgebieten sind extreme Differenzen nachweisbar. Die operativen Fächer (Chirurgie, Urologie, Augenheilkunde [stationär nur komplexe Operationen]) wurden selten von Ärztinnen geleitet. In Kliniken der Dermatologie, Psychiatrie, Gynäkologie und Kinderheilkunde waren Ärztinnen in leitenden Positionen zwar häufiger, aber im Vergleich zu Ärzten deutlich unterrepräsentiert (weniger als die Hälfte).
3.3 Studienlage
Eine horizontale und vertikale Segregation der Geschlechter ist in der Deutschen Ärzteschaft eindeutig nachweisbar und hat sich in ihrer Ausprägung in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verändert. Junge Ärztinnen wählten beispielsweise als Fachgebiete bevorzugt die Anästhesiologie (9,6 % vs. 5,4 %), Kinderheilkunde (6,3 % vs. 4,6 %) und Frauenheilkunde (9,6 % vs. 1,7 %), während Ärzte eher zu chirurgischen Fachgebieten neigten (4,6 % vs. 22,8 %) (vgl. Buddeberg-Fischer et al. 2008, 107).
Abbildung 8 Anteil der leitend-tätigen Ärztinnen in Abhängigkeit vom Fachgebiet
Sehr intensiv ausgewertet und publiziert wurde das Forschungsvorhaben „Karriereverläufe von Ärztinnen und Ärzte in der fachärztlichen Weiterbildung“ („Karmed“), die bevorzugt quantitative aber auch qualitative Verfahren einsetzten (vgl. Rothe et al. 2012). Die Präferenzen des männlichen Geschlechts für die Chirurgie (14,4 % vs. 6,9 %) und Urologie (4,4 % vs. 1,6 %) waren in der Karmed-Studie bereits am Ende des Studiums nachweisbar. Ärztinnen bevorzugten dagegen die Frauenheilkunde (10,6 % vs. 2,1 %), die Dermatologie (3,4 % vs. 0,6 %) und die Kinderheilkunde (13,1 % vs. 5,6 %) (vgl. van den Bussche et al. 2013, 153). Die Anästhesiologie wurde von beiden Geschlechtern gleichermaßen gewählt (10,6 % vs. 10,0 %). Damit entsprechen die erhobenen Präferenzen in der Karmed-Studie den bundesweit nachgewiesenen Ergebnissen.
Insgesamt entscheiden sich demnach durchgehend mehr Ärzte für Chirurgie, Orthopädie und Urologie und mehr Ärztinnen für Anästhesie, Kinderheilkunde und Gynäkologie (vgl. Aßmann et al. 2008, 81f.; vgl. Stiller 2008, 151; Buddeberg-Fischer et al. 2010, 46f.; vgl. Gensch 2010, 129; vgl. Hohner et al. 2010, 143; vgl. Gedrose et al. 2011, 1244; vgl. Gibis et al. 2013, 26).
Die horizontale Segregation, die Entscheidung zugunsten bestimmter Fachgebiete, wurde nach der Zulassung von Frauen zum Medizinstudium zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ein „natürliches“ Phänomen betrachtet, weil Frauen für bestimmte Fachgebiete „von Natur aus“ prädestiniert zu sein schienen. Da Frauen sich nach traditionellem Stereotyp um die Kinder zu kümmern hätten, war die Kinderheilkunde quasi ihr „natürliches“ Terrain. So war bereits 1935 die Kinderheilkunde eine „natürliche“ Domäne der Ärztinnen, denn sie wurde damals von fast der Hälfte (43,4 %) aller Ärztinnen ausgeübt (vgl. Wetterer 2002, 465). Da die Kinderheilkunde damals auch nur ein geringes Prestige aufwies und keine besondere Karriere im Krankenhaus ermöglichte (vgl. ebd., 467), wurde diese Entscheidung von den Ärzten begrüßt, die somit keine Konkurrenz befürchten mussten.
In der Frauenheilkunde war erst in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Zunahme des weiblichen Anteils erkennbar. Historisch wurde die Frauenheilkunde zunächst ausschließlich von Frauen wahrgenommen, weil sie auf die Geburtshilfe beschränkt war (Hebammen). Frauenärzt*innen traten erst im 19. Jahrhundert durch eine zunehmende Spezialisierung in Erscheinung, nämlich als versierte Operateur*innen zur operativen Therapie von gynäkologischen Erkrankungen. Da die Gynäkologie als operatives Fachgebiet zur männlichen Domäne gehörte, wählten 1935 nur 13,7 % der Ärztinnen die Gynäkologie als geeignetes Fachgebiet (vgl. ebd., 465). Erst durch eine Veränderung des Geschlechterstereotyps („der Frauenkörper gehört den Frauen gehört“) und durch den zunehmenden Anteil nicht-operativer Tätigkeiten (Reproduktionsmedizin) stieg der Anteil an Ärztinnen deutlich an (vgl. Buddeberg-Fischer 2003, 234f.).
Für die Anästhesiologie sprach vor 20 Jahren, dass sie aufgrund ihres weiten medizinischen Spektrums ähnlich hoch angesehen war wie die Chirurgie (vgl. Buddeberg-Fischer et al. 2008, 112). Die Aufstiegschancen waren damals gut und die Teilzeitbeschäftigung in der Regel kein Problem. Allerdings verlor das Fachgebiet an Attraktivität, weil sich Anästhesist*innen nur sehr beschränkt niederlassen können und fast ausschließlich in nicht-selbständiger Tätigkeit an Krankenhäuser oder Operationsbetriebe gebunden sind. Dort führte die zunehmende Verdichtung der Tätigkeiten, verstärkt durch regelmäßige Bereitschaftsdienste in den Krankenhäusern oder Schichtdiensten auf den Intensivstationen, zu einer erhöhten Arbeitsbelastung, so dass Ärztinnen dieser zunehmend auswichen.
Insgesamt wünschen Ärztinnen eher die Niederlassung als Fachärztin oder streben eine Position als Oberärztin im Krankenhaus an, während Ärzte eher Karriereorientiert sind und Chefärzte werden wollen (vgl. Stiller 2008, 153; Buddeberg-Fischer et al. 2010, 46f.; vgl. Gensch 2010, 130; vgl. Hancke at al. 2011, A2152; vgl. Hanika 2015, 55f.). In der „Karmed“-Studie bestand bezüglich des Niederlassungswunsches kein Unterschied zwischen den Geschlechtern (vgl. Gedrose et al. 2012, 1243). Bei den Karrieren im Krankenhaus wollten dagegen mehr Ärzte Oberarzt (38,9 % vs. 26,7 %) oder auch Chefarzt (11,9 % vs. 2,2 %) werden als Ärztinnen. Insgesamt haben Ärztinnen am Ende des Medizinstudiums weniger Vertrauen in ihr Karrierepotential (vgl. Gensch 2010, 130) und verändern ihre gewählten Einstellungen auch im zweiten Weiterbildungsjahr nicht wesentlich (vgl. Birck et al. 2014, 2176), so dass eine vertikale Segregation die Folge ist.
Eine Auswertung der Krankenhausstatistik der Landesärztekammer Hessen von 1998 bis 2008 bestätigte bei einer zunehmende Frauenquote in allen Fachgebieten die weiterhin bestehende horizontale Segregation (vgl. Kuhlmann und Larsen 2012, 222). Die Anteile in der Anästhesie (39 %) und Neurologie (28 %) hatten sich nicht verändert. Die in der Psychiatrie hatten sich vermindert (45 % auf 40 %) und die in der Chirurgie (9% auf 16 %), Inneren Medizin (16 % auf 27 %) und Kinderheilkunde (29 % auf 40 %) hatten sich erhöht. Der Anteil in der Frauenheilkunde hatte sich sogar verdoppelt von 24 % auf 48 % (vgl. ebd., 223).
Außerdem erhöhten sich die Quoten der Teilzeitbeschäftigung in allen Fachbereichen, aber bei Ärztinnen stärker als bei Ärzten (vgl. ebd., 224f.). Die zunehmende absolute Zahl an Ärzt*innen entsprach aber nicht den Stellenzahlen in den Kliniken, weil einige Fachgebiete wie die Anästhesiologie besonders viele Teilzeitstellen (51 %) aufwiesen. Insgesamt schwankte die Frauenteilzeitquote in den einzelnen Fachbereichen von 23 % bis 51 %, während die Männerteilzeitquote nur 2 % bis 18 % betrug (vgl. ebd., 224f.).
Der Anteil an Ärztinnen in höheren Positionen war auch in Hessen weiterhin deutlich geringer als der der Ärzte, mit einer Männerdomäne in der Chirurgie (vgl. ebd., 226). Insgesamt scheint sich aber in der Frauenheilkunde eine deutliche Zunahme der weiblichen Entscheidungsmacht zu entwickeln (vgl. ebd., 228).
4. Geschlechtersegregation
Die seit Jahrzehnten bestehende geschlechtliche Segregation der Ärzteschaft in den unterschiedlichen ambulanten und stationären Fachbereichen ist unverändert nachweisbar und wird selbst durch die zunehmende Feminisierung wenig tangiert. Dieser Tatbestand verwundert, weil von der akademisch gebildeten Ärzteschaft eigentlich zu erwarten gewesen wäre, dass sie eine aufgeklärte Gleichstellung beider Geschlechter vertritt – in Theorie und Praxis. Die weit verbreiteten Gleichheitsvorstellungen der Handelnden und ihre damit verknüpften normativen Selbstansprüche scheinen im Widerspruch zu stehen mit den tatsächlich gelebten Mustern und ungleichen Lebensverläufen von Ärztinnen und Ärzten (vgl. Speck 2019, 67), so dass eine deutliche Widersprüchlichkeit zwischen normativen Egalitätsforderungen und inkorporierten Geschlechtervorstellungen unverkennbar ist (vgl. Ranftl 2017, 197). Ob diese Widersprüchlichkeit rechtfertigt, bereits von einer „Paradoxie der Gleichheit“ zu sprechen (vgl. Speck 2019, 66f.), oder ob es nachvollziehbare Gründe für die gewählten Handlungsweisen in der Ärzteschaft gibt, soll nun auf allen drei Ebenen evaluiert werden, indem die in der Literatur verfügbaren Gründe analysiert werden.
4.1 Institutionelle Ebene
4.1.1 Geschlecht als Institution
Geschlecht ist eine polymorphe Institution, die sich in allen Säulen auswirkt – auf die geschlechtliche Arbeitsteilung, Arbeitszeitregelungen, Geschlechterpolitik, rechtliche Regelungen oder öffentliche Kinderbetreuung (vgl. Heintz 1998, 78; vgl. Nentwich und Kelan 2014, 125). Sie agiert als historisch etablierte Institution und als „tragende Säule der Gesellschaft“ allerdings außerordentlich träge auf Veränderungen, denn die Geschlechterordnung soll den Individuen einerseits Sicherheit und Orientierung vermitteln und andererseits die gesellschaftliche Ordnung stabilisieren, auch wenn dadurch Ansichten reproduziert und verstärkt werden, die eine geschlechtliche Ungleichheit fördern und zum Beispiel Männern in Frauenberufen besonders leicht Vorteile sichern (vgl. Gildemeister 2010, 142). Es wundert deshalb nicht, dass die seit Jahrzehnten geäußerte massive Kritik über die Gleichstellung der Geschlechter die Geschlechterdifferenzen kaum erodierte (vgl. Funder und Walden 2018, 53).
Nach dem hier verwendeten Säulen-Modell der Institution nach Scott wird verständlich, dass die erreichte Gleichstellung in der regulativen Säule nicht zwangsläufig eine Implementierung in den anderen Säulen bedeutet. Die Gleichstellung verträgt sich ohne weiteres mit einer kulturell-kognitiven Ungleichheit, die sich durch deren präskriptive Wirkung auch auf die normative Säule auswirkt. Damit erweist sich Geschlecht in ihrer Vielgestaltigkeit zwar als widersprüchlich (vgl. Funder 2018, 311), aber dennoch als sozial stabilisierend und handlungsregulierend. Eine langfristige Veränderung der Institution wäre deshalb nicht allein durch Quoten (regulativ) oder publizierte Leitbilder (normativ), sondern nur durch ergänzendes Umdenken der heterosexuellen, zweigeschlechtlichen Ordnung und Restrukturierung der dichotomen Begrifflichkeit (kulturell-kognitiv) zu erwarten (vgl. ebd., 316). Was zusätzlich voraussetzt, dass diese Veränderungen tatsächlich von der (Mehrheit der) Gesellschaft angestrebt werden.
4.1.2 Geschlechterstereotype
Geschlechterstereotype umfassen das akzeptierte Verständnis über die typischen Eigenschaften von Frauen und Männern und wirken sowohl deskriptiv als auch präskriptiv (vgl. Eckes 2010, 178). Im Stereotyp der Frau wird der Gemeinschaftssinn als vorherrschendes Merkmal angesehen, das sich sehr vielfältig äußern kann: 1. in der Sorge für andere als gütig, mitfühlend und rücksichtsvoll; 2. in der Zugehörigkeit als warm, freundlich und behilflich; 3. in der Ehrerbietung als gehorsam, respektvoll und bescheiden; und 4. in der gefühlsbetonten Empfindlichkeit als einfühlsam, intuitiv und verständnisvoll (vgl. Heilman 2012, 115). Bei Männern ist das prägende Merkmal dagegen die Handlungsfähigkeit, die sich differenzieren lässt: 1. in Leistungsorientierung als kompetent, ehrgeizig und fokussiert; 2. in Rationalität als analytisch, logisch und objektiv; 3. in einem Hang zur Führung als durchsetzungsfähig, konsequent und dominant; und 4. in Eigenständigkeit als unabhängig, selbständig und entschlussfreudig. Die genannten Eigenschaften der Stereotype unterscheiden sich dabei nicht nur, sondern stehen sich auch gegensätzlich gegenüber, so dass bei Männern dasjenige fehlen soll, was bei Frauen vorherrscht (vgl. ebd., 115).
In abstrakter Form können die Stereotype nach den Dimensionen der „Wärme“ (geringes Bestreben zum Wettbewerb) und der „Kompetenz“ (Statusempfinden) eingeteilt werden (vgl. Fiske et al. 2002, 882). Das Konzept der „Wärme“ soll den sympathischen Eindruck einfangen, den jemand gewinnt, wenn er die Absichten einer anderen Person beurteilt. Das Konzept „Kompetenz“ bildet dagegen die emotionslose Fähigkeit ab, dasjenige auch zu erreichen, was gewollt wird (vgl. ebd., 879). Auf diese Weise wird die Wärme mit Sympathie und Weiblichkeit verbunden, die sich zugleich als gemeinschaftsbezogen, moralisch und sozial interaktiv präsentiert, während die Kompetenz mit Kälte und Männlichkeit gekoppelt ist, die fokussiert, durchsetzungsfähig und performativ erscheint (vgl. Ginal 2019, 137).
Die Geschlechtertypisierung ist ein Prozess, der bereits im Kleinkindalter einsetzt und zunächst zu einer sehr groben Typisierung führt, die dann durch Substereotype weiter konkretisiert wird (vgl. Eckes 1994, 56). Die Subtypisierung nutzt die Kategorisierung in Wärme (hoch/niedrig) und Kompetenz (hoch/niedrig) und gelangt zum paternalistischen (Kn, Wh), bewundernden (Kh, Wh), verachtenden (Kn, Wn) und neidvollen (Kh, Wn) Stereotyp. Besonders problematisch sind das paternalistische und das neidvolle Stereotyp, weil es das traditionelle Geschlechterbild im ersten Fall positiv und im zweiten Fall negativ konnotiert (vgl. Eckes 2010, 182f.). Dadurch werden kompetente Frauen als kühl und unsympathisch und feminine Männer als nicht kompetent ausgewiesen.
Die aufgeführten Geschlechtsunterschiede sind kulturübergreifend nachweisbar (vgl. Williams et al. 1999, 520; vgl. Eckes 2010, 179), aber die Streubreite innerhalb der Geschlechter ist sehr groß, so dass die geringen Unterschiede zwischen den Geschlechtern kaum ins Gewicht fallen (vgl. Steffens und Ebert 2016, 101). Deshalb wird gefordert, nicht von einem Geschlechterunterschied zu sprechen, sondern von einer großen Ähnlichkeit der Geschlechter (vgl. Connell 2013, 95f.).
Im langfristigen Vergleich von 1983 und 2014 fanden sich kaum Unterschiede in den Stereotypen (Kompetenz versus Gemeinschaft), Rollenverhalten, geschlechtsspezifischen Berufen oder körperlichen Merkmalen (vgl. Haines et al. 2016, 6), so dass sich die Stereotype inhaltlich über die Jahrzehnte hinweg kaum gewandelt haben. Männer werden weiterhin als handlungskompetenter und mit einer geringeren Gemeinschaftskompetenz eingeschätzt (vgl. Hentschel et al. 2019, 11), während Frauen geringere Führungskompetenzen und Durchsetzungsfähigkeiten haben sollen.
Da die Stereotype selbstverständlich auch für Ärzt*innen handlungsleitend sind, wundern die Entscheidungen zugunsten einiger Fachbereiche und zuungunsten der Karriere nicht, wie noch im Detail beschrieben wird. Eine Entscheidung gegen die Verhaltenserwartung, die durch das Stereotyp vorgeschrieben ist, wird üblicherweise sanktioniert und somit vermieden. Frauen mit „männlicher“ Attitüde wirken zum Beispiel barsch und gefühllos und auf sie wird üblicherweise mit Abneigung (Abscheu) reagiert. Ärztinnen, die sich nicht primär um ihre Kinder kümmern, entwickeln zwangsläufig Schuldgefühle und empfinden sich als „Rabenmütter“. Männer mit „weiblichen“ Attitüden werden dagegen als kümmerlich und untauglich angesehen und ihnen wird der Respekt abgesprochen (vgl. Heilman und Wallen 2010, 667), so dass ein „richtiger Arzt“ ist meistens operativ tätig ist.
4.2 Organisationelle Ebene
Im vorliegenden Kontext wird jedes einzelne Krankenhaus als Organisation angesehen (vgl. Wilkesmann 2009, 132). Krankenhäuser sind vergleichsweise isomorph aufgebaut, weil sie die sozialen und politischen Anforderungen in ähnlicher Weise erfolgreich erfüllen. Dem Konzept der „Isomorphie durch Zwang“ wird gefolgt, weil Normen, Gesetze (Gleichstellungsgesetz) oder betriebliche Vereinbarungen eine Umsetzung erzwingen und dabei den Interpretationsmöglichkeiten geringe und gerichtlich überprüfbare Grenzen setzen (vgl. Amstutz und Vöhringer 2018, 118). Die „Isomorphie durch Nachahmung“ zeigt sich bei den einheitlichen Versuchen, durch Teilzeitmodelle und bessere Kinderbetreuung den Konflikt zwischen Beruf und Familie zu entschärfen (vgl. ebd., 121). Im Sinne einer normativen Isomorphie wird in den einzelnen Berufszweigen durch klare Weiterbildungsordnungen oder Habilitationsordnungen genau festgelegt, welche Anforderungen an eine Facharztweiterbildung oder wissenschaftliche Karriere gestellt werden. Der Isomorphie-Gedanke des Institutionalismus wird durch dieselben Muster der horizontalen und vertikalen Segregation in allen Krankenhäusern bestätigt, die offensichtlich mit den gesellschaftlichen Gleichstellungserwartungen in ähnlicher Weise umgehen (vgl. ebd., 112).
Krankenhäuser erwecken nach außen den Eindruck, dass Geschlechterdifferenzen nicht mehr relevant sind, obgleich sie zugleich Regeln einhalten, die diese Differenzen reproduzieren (vgl. Funder und May 2014, 208). Möglicherweise verbergen geschlechtsindifferente Krankenhausstrukturen oder –prozesse lediglich vergeschlechtliche Substrukturen und reproduzieren dadurch unbemerkt eine ungerechtfertigte Geschlechterdifferenz (vgl. Amstutz et al. 2018a, 17). Möglicherweise ist eine Geschlechterdifferenz aber auch nicht direkt in den Krankenhäusern wirkmächtig, weil die geschlechtliche Arbeitsteilung im Privaten bereits bestimmte Präferenzen für Teilzeitarbeit oder gegen eine Karriere getriggert haben. Allerdings wird aber gerade in den Krankenhäusern über Karriere, Einkommen und Anerkennung entschieden (vgl. Funder 2018, 330).
Ob und inwieweit Geschlecht gezielt als Ressource oder Machtmittel auf der Mesoebene eingesetzt wird, um eine horizontale Segregation zu erreichen (vgl. Wetterer 2002, 171), ließe sich nur empirisch überprüfen (vgl. Gildemeister 2008, 143f.; vgl. Nentwich und Kelan 2014, 130), indem zum Beispiel nach der Funktionalität der Segregation gefragt werden würde. Prima vista sind keine funktionalen Vorteile erkennbar, denn vom Geschlecht hängt weder die Bezahlung ab noch ist eine Steigerung der Effizienz oder ein verminderter Ressourcenverbrauch gesichert. Es könnte aber sein, dass Ärztinnen nicht nur einen anderen (besseren) Umgang mit Patienten pflegen, sondern dass dieser Umgang auch eine Qualitätsverbesserung bewirken könnte, weil Ärztinnen nachweislich eine geringere Anzahl an Patienten pro Zeiteinheit behandeln (vgl. Reifferscheid und Kunz 1999, A2496) oder die Indikation zu einem operativen Eingriff am Auge deutlich später stellen als Ärzte (vgl. Weingessel et al. 2011, 272), was sich auf das Behandlungsergebnis günstiger auswirkt.
4.2.1 Diskriminierendes Verhalten
In allen Organisationen bilden sich Geschlechterkulturen, die sich auf die hierarchische Ordnung auswirken und dabei Begriffskombinationen wie „Weiblichkeit und Männlichkeit“ und „Unterordnung und Vorherrschaft“ verwenden (vgl. Nentwich und Kelan 2014, 127). Das Verhaltensrepertoire reicht vom „männlichen Traditionalismus“ mit einer hegemonialen heterosexuellen Männlichkeit, über den „betrieblichen Kollektivismus“ mit einer internen Leugnung von Ungleichheit und dem „normativen Individualismus“ mit einer aufgewerteten Diversität des Einzelnen bis zum „pragmatischen Utilitarismus“ mit einer strikt ökonomischen Ausrichtung und Unbeachtlichkeit der Geschlechter (vgl. Liebig 2013, 297 ff.). In den meisten Organisationskulturen regiert allerdings weiterhin eine bewusste oder unbewusste hegemonialer Männlichkeit (vgl. von Alemann 2017, 428), die auf tradierten Stereotypen beruht.8 Beim Feuerwehrwesen konnte Horwath (vgl. Horwath 2017, 142ff.) als Geschlechterkultur vier Orientierungstypen nachweisen: 1. Einen Traditionalismus mit sexualisierter Differenz, klarer Sphärentrennung und Exklusion von Frauen; 2. einen Paternalismus mit natürlich bestimmter Geschlechtsdifferenz, Gleichwertigkeit der Geschlechter und partieller Integration; 3. einen ambivalent-flexiblen Egalitarismus mit leistungsbezogener Differenz, Gleichbehandlung und selektiver Integration sowie 4. eine reflektierende Orientierung mit akzeptierter sozialer Differenz, Chancengleichheit und proaktiver Integration. Es wird unterstellt, dass sich die zweite, dritte und vierte Kultur auch im Krankenhaus nachweisen lassen würde, wobei die einzelnen Fachbereiche sich in ihren Ausprägungen unterscheiden.
Konkret scheint die horizontale Segregation partiell auf der Übertragung von „weiblichen“ Charaktereigenschaften zu beruhen, die Ärztinnen als besonders geeignet für bestimmte Fachbereiche erscheinen lassen und weniger geeignet für die „männlichen“ Bereiche. Problematisch ist dabei der diskriminierende Gebrauch der Adjektive „weiblich“ und „männlich“ wie in „weiblichem Führungsstil“, „weibliches Denken“ oder „männliches“ Arbeitsvermögen“ (vgl. Wetterer 2002, 192), weil dadurch eine traditionelle Stereotype aktiviert wird und die berufliche Segregation als durch „natürliche Umstände“ entstanden suggeriert wird. Es wird unterstellt, dass sich Frauen in ihren reproduzierenden Tätigkeiten in der Privatsphäre besondere Kompetenzen aneignen, die sich auch für den produktiven Bereich profitabel nutzen lassen (vgl. ebd., 193).
4.2.2 De-Thematisierungsstrategien
Organisationen (Krankenhäuser) neutralisieren die Geschlechterdifferenz diskursiv nach Außen, indem sie sie ausschließlich als Leistungsdifferenz deklarieren und dem Geschlechtsunterschied zugleich als unerheblich unterstellen (vgl. Ginal 2019, 200). Diese Strategie der De-Thematisierung basiert auf einer strikt individuellen Perspektive, in der es jedem Individuum selbst überlassen bleibt, inwieweit es sich in einer meritokratischen Gesellschaft einbringen will, um Karriere zu machen und damit dasjenige zu erhalten, was es verdient (vgl. Funder und Walden 2018, 50), und alle sonstigen „Zwänge“ auf der Handlungsebene (s. Kapitel 4.3) werden nicht beachtet. Aus dieser Perspektive müssten Ärztinnen nur dieselben Leistungen erbringen wie Ärzte, um zum Beispiel dieselben leitenden Positionen einnehmen zu können; und weil sie nicht dieselben Leistungen erbringen, machen sie keine berufliche Karriere.
„Offensichtlich trägt der feste „Glaube“ an Leistungsgerechtigkeit dazu bei, dass Geschlechterungleichheit in Organisationen nicht thematisiert wird, da unter dieser Prämisse Ungleichbehandlung, Chancengleichheit und Diskriminierung normativ ausgeschlossen wird. Gesteigert wird dies sogar noch, wenn aus der Leistungs- eine Erfolgsorientierung wird, was in (spät)modernen Organisationen bereits der Fall ist.“ (Funder 2018, 333). Erfolg ist aber gerade nicht allein ein Produkt der eigenen Leistungsfähigkeit, sondern bereits ein Produkt der herrschenden Geschlechterverhältnisse. Wird allein auf die individuelle Performanz abgestellt und diese Sichtweise noch als objektiv dargestellt, dann ist das Geschlecht kein Thema mehr. Beispielhaft können dann Quotenregelungen ungeniert als unsachlich und ungeeignet thematisiert werden, weil sie sich angeblich gegen das anerkannte Leistungsprinzip stellen (vgl. ebd., 335).
4.2.3 Entkoppelung
Ein andere Strategie, widersprüchliche Anforderungen in einer Organisation zu entgehen, ist die Entkoppelung zwischen einer nach außen vorgetragenen Fassade zur Aufrechterhaltung der Legitimation von Gleichstellungserwartungen (vgl. Horwath 2017, 128) und der tatsächlichen Arbeitsweise innerhalb der Organisation, die effizienten Ansprüchen und Funktionen folgt (vgl. Hericks 2017, 203). Ursachen der Entkoppelung sind widersprüchliche Erwartungen, die sich einerseits aus der normativen Gleichstellungsforderung und der tatsächlichen Ungleichheit ergeben. So ist die fest verankerte Institution Geschlecht in ihrer traditionellen Form völlig unvereinbar mit einer geschlechtsneutralen Leistungsorientierung. In einen Unternehmen stoßen unter den gegenwärtigen ökonomischen Prinzipien zwangsläufig das Primat der Effizienz und das Primat der Geschlechtergerechtigkeit aufeinander, so dass nicht zu erwarten ist, dass sich mit der optimalen Allokation von Humanressourcen vereinbaren lassen (vgl. ebd., 208).
Die Entkoppelung ist kein überraschendes Ergebnis und auch kein geheimnisvolles Konzept von Organisationen, sondern sie wird trotz Gleichstellung in der regulativen Säule dadurch „legitimiert“, dass in der kulturell-kognitiven Säule präskriptive Inhalte enthalten sind, die sich zwar normativ auswirken, aber als widersprüchlich bestehen bleiben dürfen. Ein Wandel wäre demnach nur erreichbar, wenn sich alle drei Säulen gleichartig verändern würden (vgl. Eberherr und Hofmann 2018, 48).
Auch die für Väter oder Mütter offiziell angebotenen Erleichterungen, um Beruf und Familie zu vereinbaren, werden de facto kaum genutzt, weil sie mit den organisationalen Anforderungen an effiziente Abläufe unvereinbar sind (vgl. von Aleman 2017, 421) und befürchten lassen, dass ihre Nutzer von wichtigen Projekten abgezogen werden oder dass ein familienfreundliches Verhalten die zukünftige Karriere gefährdet (vgl. ebd., 422). Stattdessen werden flexible Arbeitszeiten zugunsten der Organisation oder die Anwesenheit am Arbeitsplatz belohnt und damit eine gewisse „Scheinheiligkeit“ durch Entkoppelung offenbart.
Insgesamt führen organisatorische Abläufe im Krankenhaus zu Zwängen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich erschweren und dadurch diejenigen Personen benachteiligen, die in einer Partnerschaft die Fürsorgearbeit leisten wollen. Einerseits werden „die weiblichen Fähigkeiten“ in einigen Bereichen besonders geschätzt, aber andererseits geschlechtliche Unterschiede gezielt de-thematisiert, indem nur auf die erbrachten Leistungen im Krankenhaus geachtet wird.
4.3. Handlungsebene
Die Unstimmigkeiten im Umgang mit Geschlechterdifferenzen beruhen zum größten Teil im Widerspruch zwischen Struktur und Handeln, denn einerseits wird die kritisierte Differenz im Handeln des Einzelnen reproduziert und andererseits sieht sich das Handeln konkret im heteronormativen System der traditionellen Zweigeschlechtlichkeit und geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung gefangen (vgl. Müller Ursula 2013, 534).
Für die weitere Betrachtung ist darauf hinzuweisen, dass die Handelnden in der Regel über ein implizites oder explizites Wissen der Geschlechterstereotypen verfügen und dass dieses Wissen ihre Entscheidungen maßgeblich beeinflusst – auch wenn der Einfluss von Geschlechterungleichheiten vielen Personen im Alltag nicht bewusst ist. Das „objektive“ Wissen der nicht hinterfragten Institution Geschlecht wird im „subjektiven Deutungsschema“ des Handelnden konkretisiert und dadurch wie selbstverständlich – bewusst und unbewusst – reproduziert wie es in den Dual-Prozess-Modellen konzipiert wird.
4.3.1 Kognitive Regeln
4.3.1.1 Kompetenzen
Die Stereotype bedingen Geschlechtsrollen, die sowohl die Ärzt*innen-Patienten-Beziehung definieren als auch die Ansichten, was eine gute Ärzt*in auszeichnet. Der „männlichen“ Stereotype entspricht ein zielstrebiger, selbstsicherer, aktiver und entscheidungsfreudiger Arzt, während der „weiblichen“ Stereotype eher eine behutsame, einfühlsame, hilfsbereite und verständnisvolle Ärztin gleichkommt (vgl. Buddeberg-Fischer 2003, 235). Und tatsächlich sind Personen, die als aktiv, durchsetzungsfähig, führungsstark und entscheidungsfreudig gelten, auch erfolgreicher im medizinischen Beruf (vgl. Abele 2013, 47), während das auf einfühlsame, hilfsbereite, freundliche und verständnisvolle Personen nicht gleichermaßen zutrifft.
Chirurg*innen und Anästhesist*innen neigen insgesamt in ihren Persönlichkeiten eher zu einem höheren Kohärenzsinn, zu mehr Selbstbewusstsein und Instrumentalität und somit zu einer sachlichen oder technischen Orientierung. Allgemeinmediziner und Psychiater bevorzugen dagegen eher eine personenorientierte Sichtweise. Diejenigen Personen, die ein chirurgisches Fachgebiet wählen, sind stark motiviert, handlungs- und leistungsorientiert, während die Frauenheilkunde eher von Personen gewählt wird, die mehr personen- und sozialorientiert agieren (vgl. Buddeberg-Fischer et al. 2008, 113). In der multifaktoriellen Analyse zeigte das Geschlecht zwar einen signifikanten Einfluss auf die Fachgebietswahl (vgl. ebd., 110), aber weniger durch die Persönlichkeitsmerkmale der Ärzt*innen als durch die Motivation zur Karriere und den persönlichen Lebenszielen.
4.3.1.2 Lebensentwürfe und Selbstentwicklung
Berufsanfänger beider Geschlechter entwerfen ihr Leben mit einem hohen Anspruch gegenüber ihrer eigenen Individualität, so dass sie in Abhängigkeit von ihren besonderen Fähigkeiten und Talenten festlegen, wie sie sich zukünftig verwirklichen wollen (vgl. Schwiter 2015, 64). Die Wahlfreiheit und Individualität werden zwar mit einer gewissen Unplanbarkeit verknüpft (vgl. ebd., 66), dennoch fühlen sich nur wenige Personen überfordert oder gar orientierungslos (vgl. ebd., 67). Bei dieser Wahl des Berufsanfängers wird das eigene Geschlecht erst thematisiert, wenn das beabsichtigte Vorgehen den etablierten Geschlechternormen widerspricht (vgl. ebd., 70) und zum Beispiel ein Mann Hebamme werden möchte.
Zum Ende des Medizinstudiums unterscheiden sich beide Geschlechter kaum in ihren Lebensentwürfen und beide sehen sich als emanzipiert und gleichgestellt an. Für beide Geschlechter scheint der Lebenshorizont noch vergleichbar, weil ihnen aufgrund derselben Ausbildung dieselben Chancen offenstehen. Allerdings wird dieser Horizont durch die Entscheidung für oder gegen eine Familie oder Kind unterschiedlich stark eingeschränkt, so dass sich die „biographischen Horizonte“ deutlich verschieben und Ärztinnen häufiger Brüche in Kauf nehmen bzw. ihre Biographien ändern als Ärzte (vgl. Keddi 2008, 438). Für Ärztinnen ist es sehr viel komplexer und widersprüchlicher als für Ärzte, die Projekte „Liebe“, „Beruf“, „Familie“, „Selbstentwicklung“ und „Gleichstellung“ in einem Lebenszusammenhang zu gestalten (vgl. ebd., 438f.).
Die Geschlechterstereotype stellen insgesamt widersprüchliche Anforderungen, indem einerseits von den gut ausgebildeten Ärztinnen erwartet wird, dass sie ihre hohen Qualifikationen in der Karriere und in hoch dotierte Positionen umsetzen. Andererseits wird erwartet, dass Ärztinnen auch weiterhin die familiäre Arbeit im selben Maße ausüben (vgl. Abele 2003, 170f.). Diese widersprüchlichen Erwartungen begegnen die Ärztinnen, indem sie sich gleichzeitig vielfältigeren Zielen widmen und dadurch private und berufliche Bedürfnisse zu befriedigen versuchen. Insgesamt zeichnet sich die gesamte Lebensplanung bei Ärztinnen durch eine Mischung vielfältiger Motive und weniger auf eine enggeführten Karriereplanung aus.
Frauen schätzen sich selbst kritischer ein als Männer und neigen mehr zur Selbstunterschätzung, so dass ihre subjektiven Erfolgserwartungen zu niedrig sind (vgl. Tonn 2016, 77). Ärztinnen sind insgesamt pessimistischer bezüglich ihrer beruflichen Karriere (vgl. Abele und Nitzsche 2002, 2060; vgl. Hanika 2015, 57) und im Laufe der Weiterbildung sinkt das berufliche Selbstvertrauen der Ärztinnen im Vergleich zu Ärzten weiter, so dass ein zunehmender Schereneffekt zu Ungunsten der Ärztinnen eintritt. Interessanterweise sind beide Geschlechter dennoch mit ihrem Berufsverlauf gleichermaßen zufrieden (vgl. Rohde et al. 2004, A234; vgl. Römer et al. 2017, 51). Die niedrigsten Werte der Zufriedenheit mit dem Berufsverlauf sind bei Ärztinnen mit Kindern nachweisbar (vgl. Römer et al. 2017, 49).
Offensichtlich wirken die kognitiv verankerten Stereotype auf Handlungsmöglichkeiten, indem geschlechtstypische Kompetenzen zugewiesen, unterschiedliche Lebenshorizonte entworfen und zugleich widersprüchliche Erwartungen artikuliert werden.
4.3.2 Normative Regeln
4.3.2.1 Modell der mangelnden Passung
Das Modell der mangelnden Passung könnte ebenfalls die horizontale Segregation partiell erklären, denn nach diesem Modell behindern normative Vorgaben des Stereotyps, dass Personen eine bestimmte berufliche Tätigkeit ausüben, weil sie angeblich für diese Tätigkeit nicht geeignet zu sein scheinen (vgl. Heilman 2012, 116; vgl. Steffens und Ebert 2016, 39). Wenn zum Beispiel eine Tätigkeit als „weiblich“ und minder qualifiziert tituliert wird, werden die dafür angestellten Frauen auch für minder qualifiziert gehalten, wobei es unerheblich ist, über welche Kompetenzen und Qualifikationen die Frauen tatsächlich verfügen (vgl. Wetterer 2002, 175).
Wird von Kinderärzt*innen eine bestimmte Hingabe und Umgang mit Kindern erwartet, von Frauenärzt*innen ein entsprechendes Einfühlungsvermögen in die Belange einer Frau oder von Chirurg*innen ein selbstbewusstes und zupackendes Handeln und werden diese Positionen zugleich mit „weiblichen“ und „männlichen“ Attributen besetzt, dann passen Ärztinnen in die Kinderheilkunde und Frauenheilkunde, während sie für die Chirurgie eher ungeeignet sind. So werden bewusst keine Ärztinnen in operativen Fachgebieten eingestellt, weil Frauen die körperlich belastenden operativen Eingriffe angeblich nicht aushalten könnten. Nach dem Modell der mangelnden Passung kommt es auf die tatsächlichen konkreten Eigenschaften einer Person überhaupt nicht an, sondern aus dem Geschlechterstereotyp wird direkt auf das zukünftige Verhalten projiziert und daraus geschlossen, dass Ärztinnen nicht mit den erforderlichen Fähigkeiten ausgerüstet sind, die Tätigkeiten erfolgreich durchzuführen (vgl. Heilman 2012, 116).
Als ein Grund für die vertikale Segregation wird immer wieder die „gläserne Decke“ genannt, die unter anderem durch Vorurteile über die Fähigkeiten von Frauen als Führungspersönlichkeiten geschürt werden, weil Frauen zur Führung angeblich weniger geeignet sein sollen und ihre tatsächliche Führungsleistung wirklich schlechter ist (vgl. Eagly und Karau 2002, 575f.; vgl. Steffens und Ebert 2016, 39). Auch hier unterliegen Frauen einem „lack of fit“, weil „Weiblichkeit“ mit ungeeigneten Merkmalen für Führungspersonen konnotiert ist. Hinzu kommt nach der Theorie der sozialen Rollen (Eagly et al. 2000), dass Mütter zwar als sympathisch („Wärme“) wahrgenommen werden, aber zugleich als weniger kompetent, während Männer als Ernährer einen hohen Status mit anderen Rollenerwartungen zeigen (vgl. Eckes 2010, 179f.).
Die normativen Vorgaben wirken sich selbst auf die Leistungsbewertungen (vgl. Steffens und Ebert 2016, 52), denn wenn das Erbringen einer bestimmten Leistung mit weiblichen Merkmalen konnotiert ist wie bei den Care-Berufen und Männer diese Leistung erbringen, dann werden sie besonders hoch bewertet. Männer müssen somit weniger in Care-Berufen leisten, um dieselbe Bewertung zu erhalten wie Frauen. Umgekehrt müssen Frauen in Führungspositionen weniger leisten, wenn das Führungsverhalten männlich konnotiert ist, und gute Führungsleistungen von Frauen würden besonders hervorgehoben.
Und wenn Frauen dennoch die Karriere wählen und in Führungspositionen aufsteigen, dann werden sie als kompetent, aber kaltherzig empfunden. Deshalb werden sie häufig nicht dafür belohnt, sondern weniger gemocht oder sogar noch sanktioniert, weil sie gegen das normative Stereotyp verstoßen (vgl. Heilman 2012, 123).
4.3.2.2 Kinderwunsch und hegemoniale Mütterlichkeit
Obgleich alle Ärzt*innen beim Berufseintritt in vergleichbaren Maß einen Kinderwunsch äußerten, hatten im Alter von 40 Jahren die Ärzte zu 75 % und die Ärztinnen zu 65 % mindestens ein Kind (vgl. Abele 2010, 152), wobei bei beiden Geschlechtern das Durchschnittsalter bei der Geburt 32 Jahre betrug. Nur 21 % der Ärzte waren bereit, die berufliche Tätigkeit wegen eines Kindes zu reduzieren, während es bei den Ärztinnen 86 % waren (vgl. Abele 2010, 153). Auffällig ist, dass Ärztinnen zu 25 % entweder nicht oder nur gering erwerbstätig waren (weniger als 10 Stunden) und in 85 % ein Kind versorgten, während das bei Ärzten nur in 3 % zutraf (vgl. Abele 2010, 154).
Bei einer Familie handelt es sich um eine gemeinsame Lebensform von Erwachsenen und Kind(ern). Die Entstehung einer Familie verändert den Lebenslauf von Ärzt*innen drastisch, wobei die Arbeitsteilung innerhalb der Familie der entscheidende Faktor für das „weibliche unterschiedliche Verlaufsmuster“ ist (vgl. Krüger und Levy 2000, 380). Solange keine Kinder zu versorgen waren, unterschieden sich die Berufsverläufe zwischen den Geschlechtern nicht wesentlich. Waren dagegen Kinder vorhanden, so hatten beide Geschlechter unterschiedliche Vorstellungen über die Kinderbetreuung. Während Ärzte kaum durch das Kind beruflich benachteiligt wurden und die Kinderbetreuung mehr auf die Partnerin abwälzten, waren Ärztinnen deutlich benachteiligt und nicht selten im Erziehungsurlaub oder sogar arbeitslos (vgl. Abele und Nitzsche 2002, 2059). Lag eine Elternschaft vor, dann waren nur 19 % der Ärztinnen mit Kind in Vollzeit beschäftigt, während es bei den Ärzten mit Kindern 97 % waren. Mütter waren zu 43 % arbeitslos, in Teilzeit berufstätig (14 %) oder erlebten eine verzögerte Berufsausbildung (24 %). Offensichtlich fühlen sich beide Geschlechter einem klassischen soziokulturellen Bild eines „guten“ Vaters und einer „guten“ Mutter verpflichtet, das während der Sozialisation und damit in Abhängigkeit vom Milieu internalisiert wurde (vgl. Kortendiek 2010, 446).
In Paaren übernehmen meistens die Mütter als treibende und organisierende Kraft die Familienarbeit, während Männer als Praktikanten fungieren. Männer fühlen sich bei der Kindererziehung eher angesprochen, wenn es um Freizeitunternehmungen oder Sport geht (vgl. Pöge 2019, 35). Der Grund dafür wird unter anderem in einer „hegemonialen Mütterlichkeit“ in der Gesellschaft gesehen.
Unter „hegemonialer Mütterlichkeit“ werden geschlechtsbezogene Handlungen in der Kinderfrühbetreuung verstanden, die zwingend von Müttern vorgenommen werden müssen und dadurch die Unterordnung und Hierarchisierung der Frauen verursachen (vgl. Ehnis 2008, 64). Mit der Geburt wird ein traditionelles Geschlechterbild aktiviert und dadurch dauerhaft in der Gesellschaft erhalten (vgl. Nentwich 2000, 97; vgl. Ehnis 2008, 56). In einer qualitativen Erhebung von Vätern wurden insgesamt vier kulturelle Barrieren nachgewiesen, die effektiv verhindern, dass Erziehungszeiten von Vätern wahrgenommen werden: Erstens könnte die psychische und physische Gesundheit eines Neugeborenen gefährdet sein, wenn das Kind nicht durch Krankheits- und Allergievorbeugende Muttermilch versorgt wird oder die Mutter-Kind-Beziehung beim Stillen das Urvertrauen des Neugeborenen beeinträchtigt wird (vgl. Ehnis 2008, 58). Diese vermeintlichen Gefahren reproduzieren eine „stillende Mutter“ als etablierte Norm. Da Männer nicht natürlich stillen können und ihnen damit die Fähigkeit abgesprochen wird, Neugeborene beruhigen zu können, empfinden sie sich zweitens als inkompetente Betreuungspersonen, die sich in Bereichen aufhalten, die üblicherweise den Müttern vorbehalten sind, weil nur sie die natürliche Kompetenz zur Beruhigung beherrschen (vgl. ebd., 60). Drittens sehen sich Väter erst als zuständig an, wenn sie mit dem Kind verbal ausreichend kommunizieren können. Väter sehen sich als Erzieher, während Mütter als Betreuer und Umsorger gelten (vgl. ebd., 62). Viertens wird von Müttern erwartet, dass sie sich um die Kinder kümmern und damit die Familienarbeit hauptsächlich übernehmen, während Väter sich in erster Linie der Erwerbsarbeit widmen (vgl. ebd., 62). Letztlich kann ein Vater nur eine Verbindung zum Kind aufbauen, wenn er zur „Mutter“ wird (vgl. Nentwich 2000, 117).
Die normativen Vorgaben der Stereotype beschränken durch eine angebliche mangelnde Passung die tatsächlichen Handlungsoptionen. Mit der „hegemonialen Mütterlichkeit“ werden normative Vorgaben implementiert, die quasi verhindern, dass Männer sich um Neugeborene kümmern.
4.3.3 Produktionsbeziehungen
4.3.3.1 Erwerbs- und Hausarbeit
In modernen Gesellschaftssystemen werden die gesellschaftlich notwendigen und nützlichen Tätigkeiten entweder der Produktion (Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistung) oder der Reproduktion (Haus, Kinder, Pflege, Ehrenamt) zugeordnet (vgl. Notz 2008, 480). Unter Haus- und Familienarbeit werden alle Arbeitsleistungen verstanden, die im Haushalt und in der Familie erbracht werden, um die Reproduktion aller Haushaltsmitglieder zu gewährleisten (vgl. Wengler et al. 2008, 15). Da Erwerbstätige sich im privaten Bereich erholen müssen, setzt Erwerbsarbeit die Hausarbeit voraus (vgl. Tonn 2016, 57).
Mit der Trennung der als männlich konnotierten Erwerbsarbeit (Produktion) in einer öffentlichen Sphäre von der als weiblich konnotierten Haus- und Familienarbeit (Reproduktion) in der privaten Sphäre etablierte sich in der bürgerlichen Familie eine Zuordnung von Arbeiten, die geschlechtsbezogen und zugleich komplementär angelegt ist. Der Mann wurde so zum Ernährer (Erwerbsarbeit) mit einem hohen Status und die Frau kümmert sich um die Hausarbeit mit einem niedrigen Status (vgl. Nentwich 2000, 100; vgl. Eagly und Karau 2002, 574). Diese praktizierte Rollenverteilung wird meistens bewusst gewollt (vgl. Nentwich 2000, 109), hängt nicht vom Einkommen oder der natürlichen Bestimmung des Geschlechtes ab (vgl. ebd., 115) und wird durch die geschlechtliche Arbeitsteilung dauerhaft reproduziert (vgl. Wetterer 2002, 26; vgl. Amstutz et al. 2018a, 15; vgl. Kahlert 2019, 142).
Damit wird festgelegt, dass Frauen für die Regeneration und Sozialisation zuständig sind, denn es obliegt ihnen, einerseits die Kindererziehung und Hausarbeit kostengünstig vorzunehmen (vgl. Becker-Schmidt 2010, 72; vgl. Rendtorff 2019, 108) und andererseits die emotionale Beziehungsarbeit, Fürsorge und Pflege zu leisten, die durch Liebe und Dankbarkeit „entlohnt“ wird (vgl. Woltersdorff 2015, 44). Hausarbeiten wie Kochen, Bügeln und Saubermachen sowie die Fürsorgearbeit, die aus Verantwortungsgefühl für das Wohlbefinden der Familienmitglieder erbracht werden (vgl. Possinger 2013, 258), werden privat und unbezahlt primär von Frauen verrichtet (vgl. Nentwich 2000, 97; vgl. Wengler et al. 2008, 16).
Erst durch die Erwerbsarbeit wird es Frauen ermöglicht, am öffentlichen Leben zu partizipieren, zusätzliche Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, zu sozialer Anerkennung zu gelangen und Kontakte über den häuslichen Bereich hinaus zu knüpfen (vgl. Becker-Schmidt 2010, 66). Diese doppelte Einbindung wird von Frauen zwar angestrebt, aber sie scheint für sie keine tatsächlichen Vorteile zu generieren, denn sie führt zu Kompromissen und Einschränkungen (vgl. ebd., 67) und auch zu widersprüchlichen Anforderungen. Mit der doppelten Vergesellschaftung der Frauen, der Eingebundenheit in den öffentlichen und den privaten Bereich, versuchen Frauen, zwischen beiden Sphären zu vermitteln und befinden sich dadurch in einem Dilemma, denn die Anforderungen der Erwerbsarbeit nehmen keinerlei Rücksicht auf die Anforderungen der Reproduktionsarbeit (vgl. Pöge 2019, 45). Dieses Dilemma wird üblicherweise zugunsten der Erwerbsarbeit gelöst, die als höherwertig gilt und eine höhere soziale Anerkennung genießt.
Das traditionelle Konzept basiert somit auf der Trennung von Arbeit und Familie und etablierte eine erwerbsorientierte Männlichkeit (vgl. Krüger und Levy 2000, 383; vgl. Liebig und Peitz 2017, 393), die die Existenz der Familie sichern soll. Damit wird den Männern eine klare Aufgabe zugewiesen, die keinen Bezug zur Fürsorge oder Kinderbetreuung hat. Bei männlich kodierten Verläufen ist die Person von der Reproduktionsarbeit weitgehend freigestellt und widmet sich der kontinuierlichen Vollzeiterwerbsarbeit. Diese Position ist für Männer bruchlos möglich und sie sind wenig darüber irritiert, keine Familienarbeit leisten zu müssen, weil sie die privilegierte Position einer berufsorientierten Männlichkeitskonstruktion einnehmen können (vgl. Pöge 2019, 203) und damit keinen widersprüchlichen Ansprüchen bezüglich der Erwerbs- und Familienarbeit ausgesetzt sind. Sie können sich ganz auf die Erwerbsarbeit konzentrieren.
Es scheint, dass eine „gewisse“ Arbeitsteilung in der Stereotype gesellschaftlicher Konsens ist und deshalb von Männern nicht wirklich erwartet wird, dass sie an der Haus- und Familienarbeit in derselben Art und Weise partizipieren wie Frauen, und dass von Frauen nicht wirklich erwartet wird, dass sie ihre Führungsfähigkeiten in der öffentlichen Sphäre in derselben Weise nutzen wie Männer (vgl. von Alemann 2017, 429). Der männlich kodierte Verlauf wird so mit „normalen“ Verhältnissen verknüpft und damit nicht nur als Norm gesetzt, sondern zugleich mit einer höheren Wertschätzung konnotiert (vgl. von Alemann 2017, 426). Aber für Väter besteht zunehmend ein ambivalentes Verhältnis zwischen einer traditionellen und modernen Versorgerrolle. Während Väter traditionell mehr als Mütter, aber auch mehr als andere Männer arbeiten und damit die Rolle des Ernährers tatsächlich wahrnehmen (vgl. Liebig und Peitz 2017, 391f.), wird von ihnen auch mehr Fürsorglichkeit und Familienarbeit erwartet. Aus der Sicht der Väter könnten diese Anforderungen aber durch die finanzielle Zuwendung der erbrachten Erwerbsarbeit substituiert werden, indem sie als eine indirekte Art der Fürsorge interpretiert wird und damit der direkten emotionalen und körperlichen Zuwendung vergleichbar ist (vgl. Possinger 2013, 259).
4.3.3.2 Vereinbarkeit
Die Erwerbsarbeit stellt bestimmte Anforderungen, die eine nahtlose Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschweren. Das Vereinbarkeitsproblem stellt sich zwar für Männer und Frauen gleichermaßen, aber es ist für Männer leichter lösbar, wenn sich die Partnerin eher für die Haus- und Familienarbeit verpflichtet fühlt (vgl. Teubner 2010, 502).
Für alle Ärzt*innen gilt, dass sie am Ende des Medizinstudiums in ihren Lebensentwürfen ähnlich sind und sich alle eine Balance zwischen Beruf und Familie wünschen und auch für durchführbar halten (vgl. Wagner 2010, 180; vgl. Gibis et al. 2013, 25), wobei Ärzte den Entwurf eher gestalten können (vgl. Rothe et al. 2012, 312), während sich Ärztinnen eher genötigt sehen, einem traditionellen Bild zu folgen und die Familienarbeit zu verantworten (vgl. Beaufaÿs 1999, 310). Dadurch ergibt sich zwangsläufig ein unauflösliches Vereinbarkeitsproblem zwischen Beruf und Familie zu Lasten der Ärztinnen (vgl. ebd., 324). Im weiteren Berufsverlauf halten es dann 88 % der Ärztinnen und 72 % der Ärzte nicht mehr für möglich, Familie und Karriere zu vereinbaren (vgl. Hancke et al. 2011, A2152).
4.3.3.3 Teilzeittätigkeit
Das klassische „Drei-Phasen-Modell“ der Beschäftigung wird seit einigen Jahrzehnten weniger befürwortet und stattdessen eine Teilzeitbeschäftigung angestrebt, mit der Beruf und Familie besser vereinbar sein sollen (vgl. Kortendiek 2010, 448). Ursächlich sind widersprüchliche Erwartungen (vgl. Rothe et al. 2012, 331f.; vgl. Speck 2019, 72), indem von den Ärztinnen erwartet wird, dass sie sich beruflich entwickeln und zugleich die Familie managen sollen (vgl. Abele 2003, S. 170). Der Ausweg aus diesem Dilemma liegt für die meisten Ärztinnen in der „sanften“ Karriere, in dem ein Fachbereich gewählt wird, der mit einem verträglichen Familienleben und einer Teilzeitbeschäftigung leichter zu bewältigen ist.
Auch für die ärztliche Tätigkeit gilt, dass die körperliche Anwesenheit als absolute Leistungsvoraussetzung angesehen wird. Wer Vereinbarkeitsangebote nutzt, setzt sich möglicherweise Benachteiligungen aus, denn von „Männern“ wird allgemein erwartet, dass sie ihre volle Leistung am Arbeitsplatz erbringen (vgl. von Alemann 2017, 428) und von „Vätern“, dass sie auch weiterhin vollverfügbar für ein Unternehmen bleiben (vgl. Liebig und Peitz 2017, 397). Diese Arbeitsmarktverfügbarkeit mit ihrer Leistungsorientierung ist so zentral, dass die Sorgeverantwortung weiterhin marginalisiert wird (vgl. ebd., 406). Selbst dem Diskurs über Vereinbarkeit und Work-Life-Balance liegt bereits ein geschlechtshierarchisches Fundament zu Grunde (vgl. Janczyk 2008, 72), weil er auf der mangelnden männlichen Beteiligung an der Haus- und Familienarbeit beruht. Durch die moderne Entgrenzung der typischen Erwerbsarbeit mit zunehmender Selbststeuerung und unter Berücksichtigung von Freizeitaktivitäten ergeben sich zwar neue Handlungsoptionen, aber sie werden de facto nicht realisiert (vgl. Janczyk 2008, 73; vgl. Liebig und Peitz 2017, 392).
Die Arbeitszeitvorstellungen unterschieden sich deutlich zwischen den Geschlechtern. Ärzte bevorzugen zu 78 % eine Vollzeitarbeit und Ärztinnen komplementär dazu in 76 % eine Teilzeitarbeit (vgl. Ziegler et al. 2017a, 1118), obgleich den Ärztinnen bewusst ist, dass sich ihre Weiterbildungszeit dadurch verdoppeln kann. Männer sind im Gegensatz zu Frauen nicht bereit, ihre Arbeitszeiten zu reduzieren (vgl. Abele 2013, 51), weil für Ärzte der Beruf die höchste Priorität hat (vgl. Buddeberg-Fischer 2002, 357; vgl. Hanika 2015, 55). Insgesamt wollen nur eine Minderheit der Ärztinnen in Vollzeit arbeiten. Die begrenzte Arbeitszeit wurde von den Ärzt*innen mit einer besseren „work-life-balance“ begründet, wobei es bei Ärztinnen um die Kindererziehung und bei Ärzten um Raum fürs Privatleben ging (vgl. Gedrose et al. 2011, 1245).
Selbst bei Teilzeitstellen wird im klinischen Bereich eine weitgehende Freistellung von Familienarbeit erwartet (vgl. Pöge 2019, 215), weil aufgrund des geringen Personals mit unverhofften Ausfällen immer eine hohe Flexibilität erforderlich ist. Obgleich die Teilzeitbeschäftigung offiziell gefördert wird, werden diejenigen, die tatsächlich in Teilzeit beschäftigt sind, nicht in der derselben Art und Weise tätig wie Vollzeitbeschäftigte, sondern es werden ihnen häufig eher randständige Tätigkeiten zugeordnet, die auch nicht karriereförderlich sind (vgl. Hericks 2017, 211). So werden die unbeliebten Arbeiten auf der Krankenstation oder in der Ambulanz mehr von Teilzeitbeschäftigten übernommen, während die „Vollzeit-Chirurgen“ die „eigentliche und anspruchsvolle“ Arbeit im Operationssaal übernehmen. Damit verhindert die Teilzeitbeschäftigung den Zugang zu wichtigen Weiterbildungsressourcen und verringert damit zukünftige Handlungsoptionen und schwächt somit die eigene Macht zur Überwindung der Ungleichheit (vgl. Tonn 2016, 144).
Im Krankenhaus und in der Niederlassung zeugt die körperliche Anwesenheit vor Ort von einer hohen Motivationslage der Ärzt*in (vgl. Tonn 2016, 214). Eine Tätigkeit in hohen Positionen setzt wie selbstverständlich ein fokussiertes „Leben im Dienst der Arbeit“ voraus, so dass sie unvereinbar erscheinen mit einer Teilzeitbeschäftigung oder „Ablenkung“ durch Hausarbeiten. Das gesamte persönliche Engagement wird letztlich an der zeitlichen Einsatzbereitschaft gemessen und davon der „ernsthafte“ Karrierewille abgeleitet (vgl. ebd., 226).
Die Produktionsbedingungen im ärztlichen Bereich begünstigen demnach das männlich konnotierte Ernährermodell mit vollumfänglicher Verfügbarkeit der Arbeitskraft. Dadurch wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie derartig eingeschränkt, dass bestimmte Fachbereiche bevorzugt und eine „sanfte“ Karriere gewählt werden.
4.3.4 Machtbeziehungen
In Langzeitstudien über die berufliche Laufbahnentwicklung von Akademiker*innen („BELA-E“) oder Ärzt*innen („Karmed“) (s. Kap. 3.3) waren die beiden Faktoren Elternschaft und Partnerwahl am wirkmächtigsten, weil sie direkt die geschlechtliche Arbeitsverteilung und damit die berufliche Entwicklung beeinflussten. Obgleich sich der grundsätzliche Kinderwunsch zwischen den Geschlechtern nicht unterschied, waren deutliche Unterschiede in der angestrebten und tatsächlichen Kinderbetreuung nachweisbar. Bei den kinderlosen Ärzt*innen bestand kein geschlechtlicher Unterschied in der beruflichen Entwicklung. Wenn dagegen eine Elternschaft vorlag, dann unterschied sich die berufliche Entwicklung drastisch, denn nur 19 % der Ärztinnen mit Kind waren in Vollzeit beschäftigt, während es bei den Ärzten mit Kindern 97 % waren. Mütter waren zu 43 % arbeitslos, in Teilzeit berufstätig (14 %) oder erlebten eine verzögerte Berufsausbildung (24 %) (vgl. Abele und Nitzsche 2002, 2060).
4.3.4.1 Elternschaft
Bei Ärztinnen ist wie bei anderen Akademikerinnen eine typische Verlängerung der Lebensphase „junge Frau“ nachweisbar, bis sie eine Familie gründen und ein Kind bekommen (vgl. Keddi 2008, 436). Biographisch gesehen überlappen sich die Karrierebildung und Familiengrün-dung und stehen so im Widerspruch, weil sie unterschiedlichen Logiken folgen, denn für die Karriere wird eine dauerhafte Bereitschaft für den vollen Einsatz im Beruf gefordert und zugleich eine völlige Hingabe für die Familientätigkeit (vgl. Busch 2013, 57). Die Geburt des ersten Kindes führt fast zwangsläufig von einem modernen gleichberechtigten Geschlechterverhältnis in ein traditionelles (vgl. Kortendiek 2010, 446; vgl. Kahlert 2019, 149) durch eine ungleiche Verteilung der Fürsorgearbeit, die von diesem Zeitpunkt an meistens dauerhaft besteht und nur noch selten revidiert wird (vgl. Wengler et al. 2008, 94).
Für Frauen ändert sich nach der Geburt nicht nur der Alltagsrhythmus und der gesamte Tagesablauf, sondern Frauen wirken deutlich mehr an der Hausarbeit mit, während sich Männer weiterhin voll auf den Beruf fokussieren und sogar noch weniger Hausarbeit leisten als vorher (vgl. ebd., 19). In der Elternzeit entlasten die Väter die Mütter vorübergehend, indem sie die Fürsorgeverpflichtung der Mütter in egalitärer (tagsüber), partnerschaftlicher (halbtags) oder traditioneller („Praktikant“ der Mutter) Form übernehmen (vgl. Possinger 2013, 262). Viele Männer verzichteten aber lieber auf Elternzeit und begründen ihre Entscheidung mit finanziellen oder betrieblichen Nachteilen oder der „hegemonialen Mütterlichkeit“ (vgl. ebd., 267ff.).
Für Frauen ist bis zur Geburt der männlich kodierte Berufsverlauf mit Fokus auf die Erwerbsarbeit unproblematisch realisierbar. Nach der Geburt konkurriert der Verlauf aber mit dem normativen Gehalt einer guten Mutter (vgl. Pöge 2019, 201). Bei einem weiblich kodierten Verlauf übernimmt eine Person die Verantwortung über die Kinderbetreuung und übt dann nur noch eine diskontinuierliche Teilzeiterwerbstätigkeit aus (vgl. ebd., 200). Die Person ist somit sowohl in Familienarbeit als auch Erwerbsarbeit eingebunden, die sich beide nicht konfliktfrei vereinbaren lassen, weil sich die normativen Vorgaben beider Bereiche widersprechen (vgl. ebd., 202). Die besondere Deutung der Mutterschaft für das Kind im weiblichen Stereotyp ist der entscheidende normative Faktor, während die Deutung einer guten Vaterschaft nicht zwingend die Kinderbetreuung erfordert. Somit verbleibt die Hauptverantwortung für die Vereinbarkeit und Sorgearbeit bei den Frauen (vgl. Müller Dagmar 2013, 299), die sie auf drei Arten bewältigen können: primär ist die Mutter zuständig, geteilte Zuständigkeit oder Delegation nach Extern. Am Ende bleibt die Verantwortung meistens bei Großmüttern, Müttern, Töchter und Enkelinnen hängen (vgl. Woltersdorff 2015, 50).
Bereits der Eintritt in die Weiterbildung nach dem Medizinstudium war für Ärztinnen mit Kind deutlich schwieriger, denn ohne Kind war die Chance für eine Weiterbildung 4-mal höher. Väter hatten keine Probleme eine Weiterbildungsstelle zu beginnen. Ihre Chance war 12-mal höher als bei Müttern (vgl. van den Bussche 2014, e3). Überlange Weiterbildungszeiten und höhere Abbruchraten fanden sich in erster Linie bei Ärztinnen, die Mütter geworden sind (vgl. Ziegler 2017b, 13).
Die Kinderbetreuung als solche unterscheidet sich bei Sozial-, Natur- und Technikwissenschaftler*innen sowohl in Abhängigkeit vom Geschlecht als auch von der wissenschaftlichen Disziplin (vgl. Hess et al. 2011, 86). Während sich 75 % der Frauen primär für die Kinderbetreuung im ersten Lebensjahr verantwortlich fühlten, waren es nur 2 % der Männer. Bei Sozialwissenschaftlern war ein egalitäres Vorgehen in 25 % nachweisbar. Im ersten Lebensjahr wurde die Kindesbetreuung von den Wissenschaftlerinnen nur noch zur Hälfte übernommen und bei den Wissenschaftlern zu 25 %. Insgesamt artikulierten besonders Sozialwissenschaftler, aber zum Teil auch Naturwissenschaftler, eine egalitäre Arbeitsteilung, während diese von Technikwissenschaftlerinnen abgelehnt wurde (vgl. ebd., 86).
Natur- und Technikwissenschaftlerinnen vertreten eher eine traditionelle Arbeitsteilung, erwarten Hilfe vom anderen Geschlecht nur in Ausnahmefällen und hinterfragten die Geschlechterdifferenz nicht (vgl. ebd., 88). Sozialwissenschaftlerinnen versuchten ihren egalitären Anspruch dadurch einzulösen, indem sie sich primär an den Partner zur Kinderbetreuung wendeten, während Natur- und Technikwissenschaftlerinnen ihre Kinder häufig extern betreuen ließen (vgl. ebd., 88).
Ärztinnen wendeten persönlich doppelt so viel Zeit für die Kinderbetreuung auf und nutzten eine professionelle Betreuung der Kinder während der Arbeitszeit zu 77,8 %, während dieses für Ärzte nur zu 34,3 % erforderlich wurde (vgl. van den Bussche 2014, e4). Offensichtlich orientieren sich Ärzt*innen an traditionellen Rollen: Ärzte sehen eher die PartnerInnen in der Verpflichtung der familiären Versorgung und Ärztinnen sind dadurch gezwungen, die Verpflichtung zur Kinderbetreuung zu externalisieren (vgl. Hancke et al. 2011, A2150).
4.3.4.2 Partnerwahl
Die „idealen Geschlechtsverhältnisse“ in Paarbeziehungen unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Milieu (vgl. Speck 2019, 73). In einem Handwerker- und Arbeitermilieu überwiegt ein „traditionales“ Muster mit einem männlichen Ernährer, der im Zweifel auch durch Umschulung seine Rolle erfüllen soll (vgl. ebd., 74). In Dienstleistungsberufen oder bei Beamten lässt sich ein „familistisches“ Muster nachweisen, bei dem jederzeit ein pragmatischer Rollentausch des Ernährers zum Hausmann und umgekehrt denkbar ist (vgl. ebd., 74). Bei Akademikern findet sich dagegen ein „individualisiertes“ Muster mit Gleichheitsorientierung, so dass hier eine egalitäre Partnerschaft mit gleichberechtigter Autonomie und Selbstverwirklichung vorherrscht. Beide Partner gehen auch unabhängig voneinander ihrer anspruchsvollen Berufstätigkeit nach und kümmern sich in gleichem Ausmaß um die Haus- und Familienarbeit (vgl. ebd. 74).
Eine Analyse der Paarstruktur und Paardynamik offenbarte, dass akademisch gebildete Frauen bildungshomogame Partnerschaften bevorzugen (vgl. Hess et al. 2011, 100), die einem egalitären Partnerschaftsmodell unterliegen, während es für Männer weniger wichtig zu sein scheint (vgl. Reimann und Alfermann 2014, 172). Allerdings erfordert die Bildungshomogamie und das egalitäre Modell deutlich mehr Anpassungsleistungen, weil auch der Partner seine Berufsziele gleichermaßen und gleichberechtigt verfolgt. Höhere Bildung geht zwar mit egalitärer Partnerschaft einher (vgl. Wengler et al. 2008, 18), aber es endet aufgrund der unterschiedlichen Geschlechterrollen immer in einer asymmetrischen Arbeitsverteilung mit einer Doppelbelastung für Frauen (vgl. ebd., 92).
Spätestens mit der Geburt eines Kindes werden die Lebensverläufe belastet, indem die Verteilung der Hausarbeit und Familiensorge neu arrangiert werden und dann die Karrierewünsche beider Partner neu balanciert werden müssen. Die ungleiche Arbeitsteilung nach der Geburt wird von den Partnern dadurch gerechtfertigt, dass auf unterschiedliche Eigenheiten der Persönlichkeiten verwiesen wird – und damit auf die Geschlechterstereotypen (vgl. Speck 2019, 76), denn Gleichheit meint am Ende nur die „berufliche Gleichheit, präziser: gleiche Chance zur beruflichen Selbstverwirklichung.“ (vgl. ebd.,79). Dabei stehen den Paaren theoretisch drei Arrangements zur Verfügung: 1. Nach dem traditionellen Arrangement mit einem bestimmten „Mutterbild“ übernimmt die Frau diese Tätigkeiten und nimmt einen Karrierebruch hin (vgl. Bathmann 2011, 146f.). Die Karriere des Mannes wird dabei vorrangig berücksichtigt, weil Väter aufgrund weniger normative Vorgaben flexibler in ihren Handlungsoptionen sind (vgl. Pöge 2019, 218f.). 2. Nach einem umgekehrt-traditionellen Arrangement übernimmt der Mann als weniger karriereorientiert diese Tätigkeiten und unterstützt die Karriere der Frau. 3. Ein egalitäres Arrangement mit einer dauerhaft erfolgreiche Doppelkarriere wird angestrebt, indem eine Doppelung des „männlichen“ Karrieremodells versucht wird (vgl. ebd., 147), – was sich bisher bei Ärztinnen nicht rekonstruieren lässt (vgl. Reimann und Alfermann 2014, 193).
Mit der Geburt des ersten Kindes müssen sich auch die Lebensweisen in angestrebten egalitären Partnerschaften den erforderlichen Karrierelogiken anpassen. Das gelingt zum Beispiel durch eine extensive Auslagerung von Haus- und Familienarbeit (auf andere Frauen), was allerdings ausreichende finanzielle Ressourcen voraussetzt (vgl. Rusconi 2012, 274), oder aber durch Teilzeittätigkeiten beider Partner, was sich negativ auf die Karriere beider auswirken kann (vgl. Bathmann 2011, 148).
Bei angestrebten Doppelkarrieren von Paaren ist das Einkommen nur dann ein relevanter Faktor bezüglich der praktischen Arbeitsteilung, wenn von einem Partner keine Karriere mehr angestrebt wird (vgl. Pöge 2019, 217). In seltenen Fällen wird das hegemoniale geschlechtliche Deutungsmuster vom meritokratischen Prinzip „überschrieben“, wenn die Karriere bei demjenigen Partner fortschreitet, der die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung übernommen hat, oder bei demjenigen Partner nicht fortschreitet, der freigestellt wurde. In dieser Situation wird die gewählte Arbeitsteilung in Frage gestellt und muss gerechtfertigt werden (vgl. ebd., 225).
Nach dem Medizinstudium sind Unterschiede in der Partnerwahl zwischen den Geschlechtern noch nicht nachweisbar (vgl. Abele 2010, 151). 13 Jahre nach Berufseintritt waren die Partner der Ärztinnen zu 80 % Akademiker und sogar zu 40 % Ärzte, wobei die männlichen Partner zu 91 % in Vollzeit erwerbstätig waren. Bei Ärzten waren die Partnerinnen nur zu 54 % Akademikerinnen und nur zu 23 % in Vollzeit erwerbstätig (vgl. ebd., 152). Auffällig ist der konkrete Unterschied zwischen den Lebensgefährten der Ärzt*innen, denn die Partner von Ärztinnen waren älter, besser ausgebildet und häufiger in Vollzeit beschäftigt (vgl. Abele und Nitzsche 2002, 2059). Bei Ärzten war die Wahrscheinlichkeit 5-mal höher als bei Ärztinnen, dass der Partner nicht berufstätig war (vgl. van den Bussche 2014, e4).
Die widersprüchlichen Anforderungen können Ärztinnen offensichtlich auch durch die Wahl eines geeigneten Partners erfüllen, indem sie einen Partner wählen, der bereits mehr verdient, in der Karriereleiter bereits eine höhere Position erreicht hat und auch eher eine traditionelle Geschlechterrolle einnimmt. Auf diese Weise können sie sich selbst „entschuldigen“ und ihre Karrierewünsche plausibel reduzieren, wobei sich diese Desillusionierungen später als subjektives Versagen aufdrängen könnten (vgl. Abele 2003, 172).
4.3.4.3 Niederlassung
Der niedergelassene (ambulante) und stationäre Bereich sind administrativ und finanziell zwei fast vollständig getrennte medizinische Versorgungssektoren in Deutschland. Nach der Weiterbildung, die fast ausschließlich in den Krankenhäusern erbracht wird, entscheidet sich die Fachärzt*in entweder für die weitere Tätigkeit im Krankenhaus oder für die in der Niederlassung unter den Regeln der Kassenärztlichen Vereinigung für gesetzlich Versicherte.
Ärztinnen und Ärzte favorisieren gleichermaßen die im Vergleich zum Krankenhaus größere Handlungsfreiheit in der Niederlassung, die konsekutiv zu einer höheren Arbeits- und Lebenszufriedenheit führt (vgl. Abele 2010, 154). Die Niederlassung wird aber auch bevorzugt, weil Beruf und Familie besser vereinbart werden können, denn längere und unregelmäßige Arbeitszeiten durch Ruf- und Bereitschaftsdienste treten nicht auf (vgl. ebd., 155).
Die niedergelassene Ärzt*in ist üblicherweise als freiberuflicher Unternehmer tätig. Ärzt*innen in angestellter Position waren in Praxis(gemeinschaft) früher selten und wurden nach der Einführung von medizinischen Versorgungszentren zunehmend häufiger. Sie genießen auf diese Weise die Vorteile einer relativ flexiblen zeitlichen Arbeitsgestaltung, die sich durch den Zusammenschluss mehrerer Ärzt*innen sogar noch steigern lässt, und können die potentiellen Nachteile der betriebswirtschaftlichen Verantwortung abwälzen. Ärztinnen streben deshalb häufiger überhaupt keine freiberufliche selbständige Tätigkeit mehr an, sondern bevorzugen ein Angestelltenverhältnis (vgl. van den Bussche 2017, 317).
Die zunehmend Feminisierung im niedergelassenen Bereich wirkt sich besonders intensiv auf die hausärztliche Versorgung aus, denn sie wird in Zukunft in über 75 % von Ärztinnen wahrgenommen (vgl. van den Bussche 2018, 364), die bevorzugt in Teilzeitarbeit tätig sein werden, – besonders wenn sie auch noch ein Kind zu betreuen haben (vgl. van den Bussche 2019, 10).
4.3.4.4 Klinische Karriere
In der klinischen Medizin mit Versorgung von Patienten treten drei typische Berufsverlaufsmuster auf, die selten diskontinuierlich sind: 1. die Entwicklung vom Assistenzarzt zum Facharzt, dann zum Oberarzt und eventuell zum Chefarzt (als Karrieremodell im Krankenhaus); 2. die Entwicklung vom Assistenzarzt zum Dauerfacharzt im Krankenhaus ohne Karriere; und 3. die Entwicklung von der Facharztweiterbildung im Krankenhaus in die dauerhafte Niederlassung (vgl. Hohner et al. 2003, A167).
Von einer erfolgreichen Karriere in klinischen Fachbereichen wird in der Medizin erst dann gesprochen, wenn eine leitende Position als Oberärzt*in, leitende Abteilungsärzt*in oder Chefärzt*in erreicht wurde und nicht bereits, wenn die Weiterbildung mit der Anerkennung eines Facharztes abgeschlossen wurde, was nach dem Medizinstudium in der Regel eine Weiterbildungszeit von 5-6 Jahren in Vollzeit erfordert (vgl. Pöge 2019, 202). Weder die Facharztanerkennung noch die Niederlassung als Facharzt gilt somit als klinische Karriere. Sie ist auch nicht an das Einkommen gekoppelt9, sondern nur an Ansehen und Prestige (vgl. ebd., 209).
Da Ärzt*innen im Krankenhaus oder in der Niederlassung immer gemeinsam mit anderen Personen handeln, ist eine mikropolitische, strategische Perspektive hilfreich, die thematisiert, wie eigene Interessen verfolgt, Ressourcen angeeignet, Barrieren überwunden und Handlungsspielräume erweitert werden können (vgl. Rastetter 2017, 341). Auch innerhalb der Ärzteschaft werden die bewährten Instrumente der Mikropolitik wie wohlwollende Anerkennung, gezielte Abwertung, richtungsweisende Bewertungen oder erfolgsverheißende Versprechen eingesetzt (vgl. von Aleman 2017, 424), um die individuellen Interessen zu unterstützen, die nicht zwangsläufig familienfreundlich sind.
Wenn zum Beispiel allein das Leistungsprinzip zur Grundlage der Beförderung gemacht wird und dieses zugleich vage und intransparent ist und somit fast ausschließlich subjektiven Kriterien unterliegt, dann treten mikropolitische Strukturen in den Vordergrund, die die Personalförderung durch Ausgrenzungs- und Schließungsprozesse zur Frage informeller Herrschaft werden lässt (vgl. Tonn 2016, 61).
Alle Ärzt*innen werden in ihrem Karrierestreben auf der Organisationsebene durch die Arbeitsgestaltung oder fachbezogenen Anforderungen und auf der Institutionsebene durch die existierende Familienpolitik oder stereotypische „Vergeschlechtlichung“ maßgeblich beeinflusst. So erhalten Ärzt*innen in der Weiterbildung fast durchgängig nur einen befristeten Arbeitsvertrag für ihre Weiterbildungszeit von fünf bis sechs Jahren, denn unbefristete Verträge werden im Krankenhaus üblicherweise nur mit Fachärzt*innen abgeschlossen, die als Leistungsträger einer Klinik bzw. eines Institutes gelten, weil sie erst dann selbständig und eigenverantwortlich das Fachgebiet vertreten dürfen. Das Erreichen einer Position als Ober(Chef)ärzt*in setzt neben einer abgeschlossenen Weiterbildung auch eine Konzentration auf den Beruf sowie weitere subspezialisierte Kenntnisse voraus, die häufig nur durch einen besonderen persönlichen Einsatz bei kontinuierlicher Vollzeitbeschäftigung erreichbar sind, so dass ein männlich kodierter Lebenslauf so gut wie unumgänglich ist. Außerberufliche Verpflichtungen sind auf dem Weg zur höheren Position sehr hinderlich.
Besondere Führungseigenschaften, wie sie im Management unterstellt werden, sind für die leitenden Positionen im Krankenhaus bisher nicht erforderlich, so dass die Benachteiligung des weiblichen Geschlechtes nicht damit begründet werden kann, dass sie angeblich für Führungsaufgaben weniger gut geeignet sind (vgl. Tonn 2016, 76).
Frauen fokussieren sich nicht im gleichen Maße wie Männer auf die Berufsarbeit und sind eher bereit, auf die Karriere zugunsten der Familie zu verzichten (vgl. ebd., 77). In einer Befragung am Ende des Medizinstudiums wollten Ärzte 1,5mal häufiger Oberarzt und 5,4mal häufiger Chefarzt werden als Ärztinnen, die 3,7mal häufiger „nur“ Fachärztin werden wollten (vgl. Gedrose et al. 2011, 1243). Diese Einstellungen änderten sich nicht mehr im Laufe der Weiterbildung (vgl. Ziegler et al. 2017b, 14). Selbst im vierten Weiterbildungsjahr wollten Ärztinnen nur in 24,6 % Oberärztin werden, während Ärzte zu 41,2 % die Position eines Oberarztes anstrebten (vgl. Ziegler et al 2017c, e77). Chefärzt*in wollten sogar nur 1 % der Ärztinnen und immerhin 5,9 % der Ärzte werden.
Ärztinnen begrüßen im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen privaten und beruflichen Anforderungen, streben eher eine „sanfte Karriere“ an (vgl. Abele 2013, 48) und orientieren sich eher an ein integriertes Gesamtkonzept der Lebensführung (vgl. Aßmann et al. 2008, 81f.). Dieses wird meistens durch eine Tätigkeit in Teilzeit oder in Teams bzw. Gemeinschaftspraxen erreicht (vgl. Abele 2003, 171; vgl. Gensch 2010, 130). Ärzte haben demgegenüber klare Karrierepläne mit Vollzeitbeschäftigung (vgl. Abele und Nitzsche 2002, 2060; vgl. Cramer et al. 2016, 196) und rechnen dabei fest mit der Entlastung durch ihre Partnerinnen (vgl. Hohner et al. 2003, A168).
Eine ausgeglichen „work-life-balance“ ist zwar beiden Geschlechtern grundsätzlich wichtig, aber Ärztinnen sind leichter bereit, auf Karriere zu verzichten, und können dadurch sehr viel variabler in ihrer Lebensgestaltung reagieren als Ärzte, die primär und fast schon normativ auf den Berufserfolg orientiert sind (vgl. Abele 2003, 175). Was allerdings nicht ausschließt, dass karrierebewusste Ärztinnen genau in derselben Art und Weise handeln wie karrierebewusste Ärzte und gleich erfolgreich sein können (vgl. ebd., 174), wobei dieses aber einem Verzicht auf Kinder gleichkommt (vgl. Cramer et al. 2016, 200).
Ärztinnen in niedriger Position haben nachweislich mehr Kinder als in höheren Positionen und karrierebewusste Ärztinnen im Krankenhaus waren häufiger kinderlos (vgl. Beschoner et al. 2016, 1348). Frauen wird deshalb immer die potentielle Mutterschaft unterstellt, die nach traditionellem Muster konsekutiv zur Übernahme der Verantwortung für die Familienarbeit führt, so dass Frauen einem relevanten Karrierehindernis gegenüberstehen. Müttern wird zudem weniger zugetraut, weniger Leistungsfähigkeit und weniger Kompetenzen, weil sie sich auch noch der Familie verpflichtet fühlen (vgl. Busch 2013, 575). Dieses Denken verhindert dann eine individuelle Karriereförderung (vgl. Kortendiek 2018, 15), so dass einer Karriere in der Medizin nachzugehen und zugleich die Verantwortung für eine Familie zu übernehmen, unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum möglich ist.
4.3.4.5 Wissenschaftliche Karriere
Bei einem weiblichen Anteil der Medizinstudent*innen von 66 % beträgt der weibliche Professorenanteil nur 15,5 % an den Universitäten, so dass die wissenschaftliche Karriere in der Hochschulmedizin immer noch eine männliche Domäne ist (vgl. Hendrix et al. 2014, 121). Bei den erfolgreichen Promotionen beträgt der Frauenanteil zwar noch 42 %, aber er fällt bei den Habilitationen auf 23 % ab, so dass Männer immer noch häufiger bis an die Spitze der wissenschaftlichen Karriere aufsteigen als Frauen (vgl. ebd., 120).
Für eine wissenschaftliche Karriere ist eine Entgrenzung der regulären Erwerbszeit zwingend erforderlich, weil dafür kaum Freistellungen von der üblichen Tätigkeit vorgesehen sind (vgl. Pöge 2019, 215). Bei wissenschaftlichen Karrierewünschen sind außerberufliche Verpflichtungen äußerst hinderlich, weil dazu nicht nur eine kontinuierliche Vollzeiterwerbstätigkeit erwartet wird, sondern darüber hinaus weitere unbezahlte Mehrarbeit regelmäßig anfällt. Zusätzlich wird erwartet, dass für die Wahrnehmung einer wissenschaftlichen Karriere auch noch die Zeit am Abend und am Wochenende eingesetzt wird. Damit fällt Haus- und Familienarbeit in den Aufgabenbereich des Partners, der so die Karriere zwangsläufig unterstützen muss. Doppelkarrieren sind deshalb selten und bei zusätzlichem Kinderwunsch so gut wie ausgeschlossen.
Frauen sind in Natur- und Technikwissenschaften und in der Medizin in ihren Karrierebemühungen auch dadurch benachteiligt, dass nach der Promotion häufig ein Auslandsaufenthalt erforderlich wird, um sich zu habilitieren, und Frauen nur in 50 % diese Auslandserfahrungen sammeln können (vgl. Hess et al. 2011, 101). Sozialwissenschaftlerinnen müssen in der Regel keine Auslandsaufenthalte nachweisen, so dass sich hier keine Unterschiede finden (vgl. Hess et al. 2011, 101).
Ab einer bestimmten Hierarchiestufe verhindert ein unsichtbares Hindernis das weitere wissenschaftliche Fortkommen, allerdings für alle Ärzt*innen. Sie stoßen bei der Habilitation an eine „gläserne Decke“ (vgl. Hanika 2015, 55; vgl. Ginal 2019, 344)10, die eine extreme Hürde darstellt und sich durch eine vermeintliche „Bestenauslese“ auszeichnet (vgl. Beaufaÿs 1999, 308).
Indem von Frauen ohne Unterstützung durch einen entsprechenden Hintergrund oder Partner dieselbe Leistungsfähigkeit erwartet wird wie von unterstützen Männern, werden Frauen zwangsläufig dauerhaft überfordert (vgl. Ginal 2019, 170). Inwieweit Mentoring-Programme (vgl. Hülsenbeck 2017, 360ff.) geeignet sind, die mehr Ärztinnen zur Habilitation zu führen und für Professor*innenpositionen zu begeistern, ist ungewiss.
Insgesamt unterliegen Ärztinnen aufgrund ihrer Akzeptanz der traditionellen Stereotype sehr vielen Restriktionen in den Handlungsoptionen, die zwangsläufig zur horizontalen und vertikalen Segregation in der Ärzteschaft führen, weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Ärztin nicht in derselben Art und Weise gelingen kann wie bei Ärzten.
5. Ärztliche Segregation in der Übersicht
Eine kontinuierlich bestehende, horizontale und vertikale Segregation der Geschlechter in der Deutschen Ärzteschaft konnte in vielen Studien und dieser empirischen Sekundäranalyse belegt werden. Es entscheiden sich weiterhin mehr Ärzte für Chirurgie, Orthopädie und Urologie und mehr Ärztinnen für Anästhesie, Kinderheilkunde und Gynäkologie, obgleich der Anteil an Ärztinnen kontinuierlich zunimmt. Ärztinnen wünschen eher eine Beschäftigung als Angestellte, in der Niederlassung oder Krankenhaus und entscheiden sich eher für eine „sanfte“ Karriere, während Ärzte eher Karriereorientiert sind und Chefärzte werden wollen.
Aus institutioneller Perspektive sind insgesamt traditionelle Stereotype für Ärzt*innen handlungsleitend, so dass Ärztinnen Schuldgefühle entwickeln und sich als „Rabenmütter“ empfinden, wenn sie sich nicht primär um ihre Kinder kümmern. Ein „richtiger Arzt“ kümmert sich dagegen Tag und Nacht verantwortungsvoll um seine Patienten.
Aus organisatorischer Perspektive erschweren die organisatorischen Abläufe im Krankenhaus die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und benachteiligen dadurch diejenigen Personen, die in einer Partnerschaft die Fürsorgearbeit leisten. „Weibliche Fähigkeiten“ werden in einigen Bereichen zwar geschätzt, aber geschlechtliche Unterschiede systematisch de-thematisiert, indem nur auf die erbrachten Leistungen im Krankenhaus geachtet wird.
Aus der Handlungsperspektive wirken kognitiv verankerte Stereotype, indem geschlechtstypische Kompetenzen zugewiesen, unterschiedliche Lebenshorizonte entworfen und zugleich widersprüchliche Erwartungen formuliert werden. Normativ beschränken die Stereotype durch eine mangelnde Passung die Handlungsmöglichkeiten und verhindern durch das Konzept der „hegemonialen Mütterlichkeit“, dass Männer sich um Neugeborene kümmern.
Die Arbeitsbedingungen der Ärzt*innen begünstigen ein männlich konnotiertes Bild des Ernährers in Vollzeitarbeit, so dass Beruf und Familie nur vereinbar erscheinen, indem bestimmte Fachbereiche bevorzugt und eine „sanfte“ Karriere gewählt werden.
Ärzte sehen eher ihre Partnerinnen in der Verpflichtung der familiären Versorgung und Ärztinnen sind dadurch gezwungen, die Verpflichtung zur Kinderbetreuung zu externalisieren. Die widersprüchlichen Anforderungen versuchen Ärztinnen in traditioneller Weise zu erfüllen, indem sie einen Partner wählen, der bereits mehr verdient und in der Karriereleiter bereits eine höhere Position erreicht hat.
Ärztinnen suchen eher ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen privaten und beruflichen Anforderungen, streben weniger eine klinische oder wissenschaftliche Karriere an und orientieren sich an ein integriertes Gesamtkonzept der Lebensführung durch Tätigkeiten in Teilzeit oder in Teams bzw. Gemeinschaftspraxen. Ärzte bevorzugen dagegen eine Vollzeitbeschäftigung und verlassen sich bei ihrer Karriereplanung fest auf die Entlastung durch ihre Partnerin.
Sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Segregation der Ärzteschaft ist demnach zwar das Geschlecht, aber genauer die Elternschaft der wichtigste Einflussfaktor, der die geschlechtliche Ungleichheit bedingt.
6. Ausblicke
Es mag erstaunlich erscheinen, dass die geschlechtlichen Ungleichheiten weiterhin persistieren und damit verbundene Ungerechtigkeiten nicht bewirken, dass sich Geschlechterverhältnisse umverteilen (vgl. Bereswill und Liebsch 2019, 11). Diese mangelnde Konsequenz sollte aber gedanklich nicht dazu verführen, dass aus der Idee, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben (normativ), zugleich abgeleitet wird, dass sie prinzipiell auch gleiche Fähigkeiten haben müssen und dass das Geschlecht deshalb im Alltag keine Rolle spielen darf (normativ). Wer so denkt, wird durch die Realität überrascht und konstruiert ein „normatives Paradoxon“ (vgl. Speck 2019, 92), anstatt gesunden Verstand walten zu lassen.
Es kann eine optimistische oder pessimistische Perspektive gewählt werden, um mit den Erkenntnissen umzugehen. In pessimistischer Denkweise könnte auf die Persistenz der Geschlechterdifferenzen verwiesen werden, die offensichtlich unüberwindbare Hürden darzustellen scheinen, die die zweigeschlechtliche Kultur im Alltag nicht überwindet, oder die sie sogar als konstitutives Element des Kapitalismus ansieht (vgl. Müller Ursula 2013, 534). Andererseits könnte eine optimistische Sicht eine gewisse Widersprüchlichkeit der Geschlechterunterschiede erkennen und den gesamten Reproduktionsprozess der Handlungsgründe als konstruiert entlarven und damit eine bewusste Änderung einleiten – insoweit diese von der Gesellschaft gewünscht wird.
De facto sind die Geschlechterstereotypen so internalisiert, dass sie nur bei Bedarf oder bei Konflikten thematisiert werden. Solange die deskriptiven Merkmale der Geschlechterstereotypen mit einigen Merkmalen des Berufs assoziiert werden, wird die Geschlechtersegregation in der Ärzteschaft reproduziert, denn solange Frauen bei tradierten Vorbildern bleiben, ändert sich auch die Beteilung der Männer an der Familienarbeit kaum (vgl. Keddi 2008, 437). Nur tatsächlich veränderte Sorgeverhältnisse im häuslichen Bereich könnten einen dauerhaften Wandel hervorrufen (vgl. Kahlert 2019, 145).
Eine weitere Feminisierung der Ärzteschaft ist zu erwarten, so dass Konzepte entwickelt werden sollten, um die Segregation „aufzubrechen“. Die bisherigen Maßnahmen zur Überwindung der Geschlechtersegregation in der Ärzteschaft bestanden in einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flexibleren Arbeitszeiten, neuen Karrierewegen oder Mentoringprogrammen. Sie waren aber bisher kaum geeignet (vgl. Jerg-Bretzke und Limbrecht 2012, 4) einen Wandel zu bewirken, weil sie die gegenwärtigen Stereotypen nur reproduzieren und nicht ausreichend modifizieren.
Literaturverzeichnis
Abele, Andrea E. und Nitzsche Ute. 2002. Der Schereneffekt bei der beruflichen Entwicklung von Ärztinnen und Ärzten. Deutsche Medizinische Wochenschrift 127:2057–2062.
Abele, Andrea E. 2003. Beruf – kein Problem, Karriere – schon schwieriger: Berufsleben von Akademikern und Akademikern im Vergleich. In Frauen und Männer in akademischen Professionen. Berufsverläufe und Berufserfolg, hrsg. Andrea E. Abele, Ernst H. Hoff, Hans U. Hohner, 157-182, Heidelberg: Asanger.
Abele, Andrea E. 2010. Erwerbsverläufe von Frauen und Männern in der Medizin. In Arbeitsbedingungen und Befinden von Ärztinnen und Ärzten, hrsg. Friedrich Wilhelm Schwartz und Peter Angerer, 149-158, Köln: Deutscher Ärzte Verlag.
Abele Andrea E. 2013. Berufserfolg von Frauen und Männern im Vergleich. Warum entwickeln sich die „Schere“ immer noch auseinander? Gender 3:41-59.
Acker, Joan. 1990. Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. Gender & Society 4(2):139-158.
Alvesson, Mats und André Spicer. 2019. Neo-institutional theory and organization studies: a mid-life crisis? Organization Studies 40(2): 199-218.
Amstutz, Nathalie und Helga Eberherr, Maria Funder, Roswitha Hofmann. 2018a. Zwischen Beharrung und Transformation: Neo-institutionalistische Reflexionen zum Gender Cage in Organisation. In Geschlecht als widersprüchliche Institution. Neoinstitutionalistische Implikationen zum Gender Cage in Organisationen hrsg. Nathalie Amstutz, Helga Eberherr, Maria Funder, Roswitha Hofmann, 13-39, Baden-Baden: Nomos.
Amstutz, Nathalie und Melanie Nussbaumer, Ortrun Brand. 2018b. Soziale Agency: Arbeit an der (De-)Institutionalisierung von Geschlecht. In Geschlecht als widersprüchliche Institution. Neoinstitutionalistische Implikationen zum Gender Cage in Organisationen hrsg. Nathalie Amstutz, Helga Eberherr, Maria Funder, Roswitha Hofmann, 87-109, Baden-Baden: Nomos.
Amstutz, Nathalie und Hanna Vöhringer. 2018. Isomorphie: Machtvolle Angleichungsprozesse bei der Verarbeitung von Gleichstellungserwartungen. In Geschlecht als widersprüchliche Institution. Neoinstitutionalistische Implikationen zum Gender Cage in Organisationen hrsg. Nathalie Amstutz, Helga Eberherr, Maria Funder, Roswitha Hofmann, 111-136, Baden-Baden: Nomos.
Aßmann, Sabine und Götz Schneiderat, Friedrich Balck. 2008. Warum Medizin – Unterscheiden sich männliche und weibliche Studierende in ihren Beweggründen für ein Medizinstudium und in ihren beruflichen Plänen? In Karriereentwicklung und berufliche Belastung im Arztberuf, hrsg. Elmar Brähler, Dorothee Alfermann, Jeannine Stiller, 73-83, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Bathmann, Nina und Dagmar Müller, Waltraud Cornelißen. 2011. Karriere, Kinder, Krisen. Warum Karrieren von Frauen in Paarbeziehungen scheitern oder gelingen. In Berufliche Karrieren von Frauen, Hürdenläufe in Partnerschaft und Arbeitswelt, hrsg. Waltraud Cornelißen, Alessandra Rusconi, Ruth Becker, 105-149, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Beaufaÿs, Sandra. 1999. Mit freiem Kopf arbeiten: Familie und Beruf aus der Sicht von Medizinerinnen. In Vielfältige Verschiedenheiten. Geschlechterverhältnisse in Studium, Hochschule und Beruf, hrsg. Ayla Neusel, Angelika Wetterer, 305–326, Frankfurt a. M.: Campus.
Becker-Schmidt, Regina. 2010. Doppelte Vergesellschaftung von Frauen: Divergenzen und Brückenschläge zwischen Privat- und Erwerbsleben. In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 65-74, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Bereswill, Mechthild und Katharina Liebsch. 2019. Persistenz von Geschlechterdifferenz und Geschlechterhierarchie. In Struktur und Dynamik Un/Gleichzeitigkeiten im Geschlechterverhältnis, hrsg. Barbara Rendtorff, Birgit Riegraf, Claudia Mahs, 11-25. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Berger, Peter L. und Thomas Luckmann. 1969 [1999]. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. 16. Aufl., Frankfurt a.M.: Fischer.
Beschoner, P. und M. Braun, C. Schönfeldt-Lecuona et al. 2016. Gender-Aspekte bei Ärztinnen und Ärzten. Bundesgesundheitsblatt 59(10):1343-1350.
Beunen, Raoul und J.J. Patterson. 2019. Analysing institutional change in environmental governance: exploring the concept of ‚institutional work‘. Journal of Environmental Planning and Management 62(1): 12-29.
Birck, S. und B. Gedrose, B.P. Robra et al. 2014. Stabilität der beruflichen Endziele im Verlauf der fachärztlichen Weiterbildung. Ergebnisse einer multizentrischen Kohortenstudie mit zweijährigem Intervall. Deutsche Medizinische Wochenschrift 139(43):2173-2177.
Buddeberg-Fischer, Barbara und C. Illes, R. Klaghofer. 2002. Karrierewünsche und Karriereängste von Medizinstudierenden – Ergebnisse von Fokusgruppeninterviews mit Staatsexamenskandidatinnen und -kandidaten. Gesundheitswesen 64(6):353–363.
Buddeberg-Fischer, Barbara. 2003. Geschlechterstereotype in der Frauenheilkunde – Barriere für junge Ärzte? Gynäkologisch-geburtshilfliche Rundschau 43:231-237.
Buddeberg-Fischer, Barbara und Richard Klaghofer, Martina Stamm, Claus Buddeberg. 2008. Facharztwahl von jungen Ärztinnen und Ärzten – der Einfluss von Geschlecht, Persönlichkeit, Karrieremotivation und Lebenszielen. In Karriereentwicklung und berufliche Belastung im Arztberuf, hrsg. Elmar Brähler, Dorothee Alfermann, Jeannine Stiller, 101-116, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Buddeberg-Fischer, Barbara, und Martina Stamm, Claus Buddeberg et al. 2010. The impact of gender and parenthood on physicians‘ careers – professional and personal situation seven years after graduation. BMC Health Services Research 10:40.
Busch, Anne. 2013. Die berufliche Geschlechtersegregation in Deutschland. Ursachen, Reproduktion, Folgen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Connell, Raewyn. 2013. Gender. Wiesbaden, Springer Fachmedien.
Cramer, Barbara und Monika Hanika, Janine Diehl?Schmid. 2016. Küche, Kinder, Professur? Die wissenschaftliche Karriere von Ärztinnen in der Hochschulmedizin. Beiträge zur Hochschulforschung 38(1-2):190-218.
Eagly, Alice H. und Steven J. Karau. 2002. Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review 109(3): 573-598.
Eagly, Alice H. und Wendy Wood. 2013. The nature-nurture debates: 25 years of challenges in understanding the psychology of gender. Perspectives on Psychological Science 8(3):340-357.
Eberherr, Helga und Roswitha Hofmann. 2018. Geschlecht als Institution: polymorph und widersprüchlich. In Geschlecht als widersprüchliche Institution. Neoinstitutionalistische Implikationen zum Gender Cage in Organisationen hrsg. Nathalie Amstutz, Helga Eberherr, Maria Funder, Roswitha Hofmann, 43-65, Baden-Baden: Nomos.
Eckes, Thomas. 1994. Explorations in gender cognition: content and structure of female and male subtypes. Social Cognition 12(1): 37-60
Eckes, Thomas. 2010. Geschlechterstereotype: von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 178–189, 3. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Ehlert, Gudrun. 2018. Profession, Disziplin und Geschlecht. In Professionskulturen – Charakteristika unterschiedlicher professioneller Praxen, hrsg. Silke Müller-Hermann, Roland Becker-Lenz, Stefan Busse, Gudrun Ehlert, 197-213, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Ehnis, Patrick. 2008. Hegemoniale Mütterlichkeit. Vom selbstverständlichen Einverständnis in die geschlechtstypische Arbeitsteilung nach der Geburt des Kindes. In Geschlecht Macht Arbeit. Interdisziplinäre Perspektiven und politische Intervention, hrsg. Marburger Gender-Kolleg, 56-69, Münster: Westfälisches Dampfboot.
Emirbayer, Mustafa und Ann Mische. 1998. What is agency? American Journal of Sociology 103(4): 962-1023.
Esser, Hartmut. 2018. Sanktionen, Reziprozität und die symbolische Konstruktion einer Kooperations-„Gemeinschaft“. Zeitschrift für Soziologie 47(1): 8–28.
Fiske, Susan T. and Amy J. Cuddy, Peter Glick, Jun Xu. 2002. A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology 82(6): 878-902.
Förster, Jens. 2009. Die Sozialpsychologie des Schubladens: Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung. In Schubladen, Schablonen, Schema F. Stereotype als Herausforderung für Gleichstellungspolitik, hrsg. Susanne Baer, Sandra Smykalla, Karin Hildebrandt, 23-35, München: Kleine Verlag.
Frommann, Benjamin. 2014. Kompetenzen als Phänomen der Netzwerkorganisation: Strukturationstheoretische Einsichten. Wiesbaden: Springer Gabler.
Funder, Maria und Florian May. 2014. Neo-Institutionalismus: Geschlechtergleichheit als Egalitätsmythos? In Gender Cage, Revisited, Handbuch zur Organisations- und Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 195-224, Baden-Baden: Nomos.
Funder, Maria und Kristina Walden. 2018. Alte Fragen, neue Antworten? Reflexionen zum ‚Gender Cage‘ in Organisationen. Plädoyer für ein mehrdimensionales Analysemodell. In Geschlecht als widersprüchliche Institution. Neoinstitutionalistische Implikationen zum Gender Cage in Organisationen hrsg. Nathalie Amstutz, Helga Eberherr, Maria Funder, Roswitha Hofmann, 35-99, Baden-Baden: Nomos.
Funder, Maria. 2017. Neo-Institutionalismus und geschlechterorientierte Organisationsforschung – Befunde und Plädoyer für einen weiterführenden Dialog. In Geschlecht als widersprüchliche Institution. Neoinstitutionalistische Implikationen zum Gender Cage in Organisationen hrsg. Nathalie Amstutz, Helga Eberherr, Maria Funder, Roswitha Hofmann, 307-342, Baden-Baden: Nomos.
Funk, Wolfgang. 2018. Gender Studies. Paderborn, Wilhelm Fink Verlag.
Gedrose, B. und C. Wonneberger, J. Jünger et al. 2012. Haben Frauen am Ende des Medizinstudiums andere Vorstellungen über Berufstätigkeit und Arbeitszeit als ihre männlichen Kollegen? Ergebnisse einer multizentrischen postalischen Befragung. Deutsche Medizinische Wochenschrift 137(23):1242–1247.
Gensch, Kristina. 2010. Berufsentscheidungen junger Ärztinnen und Ärzte: Auswir-kungen auf das ärztliche Versorgungsangebot. In Arbeitsbedingungen und Befinden von Ärztinnen und Ärzten, hrsg. Friedrich Wilhelm Schwartz und Peter Angerer, 127-136, Köln: Deutscher Ärzte Verlag.
Gibis, Bernhard und Carl-Heinz Müller, Andreas Heinz, Rüdiger Jacob. 2013. Bundesweite Befragung von Medizinstudierenden zu ihren Berufserwartungen. In Perspektiven junger Ärztinnen und Ärzte in der Patientenversorgung. Report Versorgungsforschung, Bd. 6, hrsg. Christoph Fuchs, Bärbel-Maria Kurth, Peter C. Scriba, 23-28, Köln: Deutscher Ärzteverlag.
Giddens, Anthony. 1984 [1988]. Die Konstitution der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Campus Verlag.
Gildemeister, Regine. 2010. Doing Gender: Soziale Praktiken der Geschlechterunterscheidung. In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 137–145, 3. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Ginal, Marina. 2019. Geschlechterungleichheiten in der Universitätsmedizin. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Haines, Elizabeth L. und Kay Deaux, Nicole Lofaro. 2016. The times they are a-changing … or are they not? A comparison of gender stereotypes, 1983-2014. Psychology of Woman Quaterly 40:1-11.
Hancke, K. und B. Toth, R. Kreienberg. 2011. Karriere und Familie – unmöglich. Deutsches Ärzteblatt 108:2148-2152.
Hanika, Monika. 2015. Die wissenschaftliche Karriere in der Medizin – gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Diss. TU München (http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20150506-1231535-1-1)
Hauptmann, Stefan. 2012. Social Media in Organisationen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Heilman, Madeline E. 2001. Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues 57(4):657–674.
Heilman, Madeline E. und Aaron S. Wallen. 2010. Wimpy and undeserving of respect: Penalties for men’s gender. Journal of Experimental Social Psychology 46:664-667.
Heilman, Madeline E. 2012. Gender stereotypes and workplace bias. Research in Organizational Behaviour 32: 113-135.
Heintz, Beate und Eva Nadai. 1998. Geschlecht und Kontext. De-Institutionalisierungsprozesse und geschlechtliche Differenzierung. Zeitschrift für Soziologie 27(2):75-93.
Hendrix, Ulla und Meike Hilgemann, Beate Kortendiek, Jennifer Niegel. 2014. Geschlechter(un)gerechtigkeit an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen – der Gender-Report. Gender 2:118–127.
Hentschel, Tanja und Madeline E. Heilman, Claudia V. Peus. 2019. The multiple dimensions of gender stereotypes: A current look at men’s and women’s characterizations of others and themselves. Frontiers in Psychology 10(Article 11):1-14.
Hericks, Katja. 2017. Entkopplungen und die widersprüchlichen Institutionalisierungen von Geschlecht – zur Konzeption und Diskussion des Entkopplungstheorems. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 203-231, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Hess, Johanna und Alessandra Rusconi, Heike Solga. 2011. „Wir haben dieselben Ziele…“ – Zur Bedeutung von Paarkonstellationen und Disziplinzugehörigkeit für Karrieren von Frauen in der Wissenschaft. In Berufliche Karrieren von Frauen, Hürdenläufe in Partnerschaft und Arbeitswelt, hrsg. Waltraud Cornelißen, Alessandra Rusconi, Ruth Becker, 65-104, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Hohner, Hans-Uwe und Stefanie Grote, Ernst H. Hoff. 2003. Geschlechtsspezifische Berufsverläufe: Unterschiede auf dem Weg nach oben. Deutsches Ärzteblatt 100:A166-169.
Hohner, Hans-Uwe und Ernst H. Hoff, Stefanie Grote et al. 2010. Das DFG-Projekt „PROFIL“: Professionalisierung und Integration der Lebenssphären. Geschlechtsspezifische Berufsverläufe in Medizin und Psychologie. In Arbeitsbedingungen und Befinden von Ärztinnen und Ärzten, hrsg. Friedrich Wilhelm Schwartz und Peter Angerer, 137-148, Köln: Deutscher Ärzte Verlag.
Horwath, Ilona. 2017. Scotts Institutionenbegriff als Heuristik zur Analyse von Geschlechtsverhältnissen in Organisationen: Inspirationsquelle ‚Geschlechterwissen‘. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 125-152, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Hülsenbeck, Stefanie. 2017. Mentoring in der Hochschulmedizin. In Praxishandbuch Mentoring in der Wissenschaft, hrsg. Renate Petersen, Mechthild Budde, Pia Simone Brocke et al., 355–366, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Hwang, Hokyu und Jeanette A. Colyvas. 2011. Problematizing actors and institutions in institutional work. Journal of Management Inquiry 20(1): 62-66.
Janczyk, Stefanie. 2008. „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ und Work-Life-Balance: Über Verengungen und Ausblendungen in einer Debatte. In Geschlecht Macht Arbeit. Interdisziplinäre Perspektiven und politische Intervention, hrsg. Marburger Gender-Kolleg, 70-84, Münster: Westfälisches Dampfboot.
Jerg-Bretzke, Lucia und Kerstin Limbrecht. 2012. Wo sind sie geblieben? – Eine Diskussion über die Positionierung von Medizinerinnen zwischen Karriere, Beruf und Familie. Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 29(2):1-6.
Kahlert, Heike. 2019. Neuordnung der wohlfahrtskapitalistischen Geschlechterverhältnisse in der Spätmoderne: Reproduktionskrise und/oder unvollendete Revolution? In Struktur und Dynamik Un/Gleichzeitigkeiten im Geschlechterverhältnis, hrsg. Barbara Rendtorff, Birgit Riegraf, Claudia Mahs, 141-155. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Keddi, Barbara. 2008. Junge Frauen: Vom doppelten Lebensentwurf zum biografischen In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 436–441, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Kirchner, Stefan und Anne K. Krüger, Frank Meier, Uli Meyer. 2015. Wie geht es weiter mit dem soziologischen Neo-Institutionalismus? In: Apelt M, Wilkesmann U (Hrsg.) Zur Zukunft der Organisationssoziologie. Wiesbaden, Springer Fachmedien, S. 189-202.
Kortendiek, Beate. 2010. Familie: Mutterschaft und Vaterschaft zwischen Traditionalisierung und Modernisierung. In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 442–453, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Kortendiek, Beate. 2018. Verhältnis von Geschlecht und Organisation in der Humanmedizin an NRW-Universitäten – zentrale Ergebnisse des Gender-Report. IZGOnZeit. Onlinezeitschrift des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung, 7:4–19.
Krell, Gertraude und Renate Ortlieb, Barbara Sieben. 2018. Gender and Diversity in Organisationen. Grundlegendes zur Chancengleichheit durch Personalpolitik. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Krüger, Helga und René Levy. 2000. Masterstatus, Familie und Geschlecht. Vergessene Verknüpfungslogiken zwischen Institutionen des Lebenslaufs. Berliner Journal für Soziologie 3:379-401.
Kuhlmann, Ellen und Christa Larsen. 2012. Gesundheitsreformen und Beschäftigungssituation – Erklärungspotenziale gendersensibler quantitativer Methoden. In Erkenntnis und Methode, hrsg. Brigitte Aulenbacher und Birgit Riegraf, 217-234, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Lawrence, Thomas und Roy Suddaby, Bernhard Leca. 2011. Institutional Work: Refocusing institutional studies of organization. Journal of Management Inquiry 20(1):52-58.
Lawrence, Thomas und Bernhard Leca, Tammar Zilber. 2013. Institutional work: Current research, new directions and overlooked issues. Organization Studies 34(8): 1023-1033.
Leschziner, Vanina und Adam I. Green. 2013. Thinking about food and sex: Deliberate cognition in the routine practices of a field. Sociological Theory 31(2):116-144.
Leschziner, Vanina. 2018. Dual process models in sociology. In The Oxford handbook of cognitive sociology, hrsg. Wayne H. Brekhus und Gabriel Ignatow, 1-28, Oxford: University Press.
Liebig, Brigitte. 2013. Organisationskultur und Geschlechtergleichstellung. Eine Typologie betrieblicher Gleichstellungskulturen. In Geschlecht und Organisation, hrsg. Ursula Müller, Birgit Riegraf, Sylvia M. Wilz, 292-317, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Liebig, Brigitte und Martina Peitz. 2017. Organisationaler Wandel durch neue Väter? Eine neoinstitutionalistische Analyse aktiver Vaterschaft in Erwerbsorganisationen. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 391-414, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Lizardo, Omar and Robert Mowry, Brandon Sepulvado et al. 2016. What are dual process models? Implications for cultural analysis in sociology. Sociological Theory 34(4):287-310.
Miebach, Bernhard. 2014. Soziologische Handlungstheorie. Eine Einführung. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Miles, Andrew und Raphael Charron-Chénier, Cyrus Schleifer. 2019. Measuring automatic cognition: Advancing dual process research in sociology. American Sociological Review 84(2):306-333.
Müller, Dagmar. 2013. Die Organisation von Elternschaft und Care. In Gemeinsam zum Erfolg? Berufliche Karrieren von Frauen in Paarbeziehungen, hrsg. Nina Bathmann, Waltraud Cornelißen, Dagmar Müller, 251-300, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Müller, Ursula. 2013. Wandel als Kontinuität. Bilanz und Ausblick. In Geschlecht und Organisation, hrsg. Ursula Müller, Birgit Riegraf, Sylvia M. Wilz, 527-537, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Nagel, Sebastian und Hanna Schulte, Stefanie Hiß. 2017. Institutionen und Diskurse verknüpfen: Neue Einsichten zur Stabilität sozialer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 153-173, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Nentwich, Julia C. 2000. Wie Mütter und Väter gemacht werden. Konstruktionen von Geschlecht bei der Rollenverteilung in Familien. Zeitschrift für Frauenforschung 18(3):96–121.
Nentwich, Julia C. und Elisabeth K. Kelan. 2014. Towards a topology of ‚doing gender‘: An analysis of empirical research and its challenges. Gender, Work and Organization 21(2):121-134.
Notz, Gisela. 2008. Arbeit: Hausarbeit, Ehrenamt, Erwerbsarbeit. In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 480–488, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Pöge, Kathleen. 2019. Paare in Widerspruchsverhältnissen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Possinger, Johanna. 2013. Vaterschaft im Spannungsfeld von Erwerbs- und Familienleben. „Neuen Vätern“ auf der Spur. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Ranftl, Edeltraud. 2017. Rationalität im Neo-Institutionalismus. Rationalität aus Sicht des Ansatzes der Gendered Organization. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 175-202, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Rastetter, Daniela. 2017. Geschlechterverhältnisse in Organisationen: Zur Relevanz von Akteur_innen, strategischem Handeln und Spielen. Inspirationsquelle Mikropolitik. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 339-366, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Rendtorff, Barbara. 2019. Geschlechtervertrag und symbolische (Geschlechter)Ordnung. In Struktur und Dynamik. Un/Gleichzeitigkeiten im Geschlechterverhältnis, hrsg. Barbara Rendtorff, Birgit Riegraf, Claudia Mahs, 105-112, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Reifferscheid, Gerd und Gerhard Kunz. 1999. Unterschiedliches Rollenverhalten: Arztberuf und soziales Geschlecht. Deutsches Ärzteblatt 96(40):A2493–A2498.
Reimann, Swantje und Dorothee Alfermann. 2014. Zum Einfluss der Elternschaft auf die Karriereorientierung von Ärztinnen. Eine Fallrekonstruktion. Zeitschrift für Familienforschung 26(2):169–198.
Römer, Farina und Stine Ziegler, Martin Scherer, Hendrik van den Bussche. 2017. Die Berufsverlaufszufriedenheit von Assistenzärzten und -ärztinnen nach vierjähriger Weiterbildung. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen 120:47-53.
Rohde, Volker und Axel Wellmann, Beate Bestmann. 2004. Berufsreport: Beurteilung der Fort- und Weiterbildung. Deutsches Ärzteblatt 101:A233-A234.
Rothe, Katharina und Carsten Wonneberger, Johannes Deutschbein et al. 2012. Von Ärzten, Ärztinnen und „Müttern in der Medizin“. In Neue Geschlechterperspektiven auf Karrieren in der Wissenschaft, Einfach Spitze? hrsg. Sandra Beaufaÿs, Anita Engels, Heike Kahlert et al., 312-334, Frankfurt a. M.: Campus Verlag.
Rusconi, Alessandra. 2012. Zusammen an die Spitze? Der Einfluss der Arbeitsbedingungen im Paar auf die Verwirklichung von Doppelkarrieren. In Neue Geschlechterperspektiven auf Karrieren in der Wissenschaft, Einfach Spitze? hrsg. Sandra Beaufaÿs, Anita Engels, Heike Kahlert et al., 257-279, Frankfurt a. M.: Campus Verlag.
Rybnikova, Irma und Rainhart Lang. 2017. Mikroperspektive im Neo-Institutionalismus: Zur Rolle von individuellen Akteur_innen. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 235-262, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Schmid, Michael. 2018. Der „Neue Institutionalismus“. Studien zum Vergleich seiner Forschungsprogramme. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Schwiter, Karin. 2015. Auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. Junge Erwachsene im Spannungsfeld zwischen Individualität und Geschlechternormen. In Des eigenen Glückes Schmied_in!? Geschlechterreflektierende Perspektiven auf berufliche Orientierungen und Lebensplanungen von Jugendlichen, hrsg. Christiane Micus-Loos und Melanie Plößer, 61-75, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Scott, Richard W. 2008. Institutions and organizations: Ideas and interests. 3. Aufl., Thousand Oaks: Sage Publications.
Speck, Sarah. 2019. Paradoxien der Gleichheit: Widersprüchliche Verkehrungen in zeitgenössischen Geschlechterverhältnissen. In Struktur und Dynamik Un/Gleichzeitigkeiten im Geschlechterverhältnis, hrsg. Barbara Rendtorff, Birgit Riegraf, Claudia Mahs, 65-96. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Steffens, Melanie C. und Irena D. Ebert. 2016. Frauen. Männer. Karrieren. Eine sozialpsychologische Perspektive auf Frauen in männlich geprägten Arbeitskontexten. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Stiller, Jeannine und Cindy Busse. 2008. Berufliche Karriereentwicklung von Ärztinnen und Ärzten – Die ersten vier Berufsjahre. In Karriereentwicklung und berufliche Belastung im Arztberuf, hrsg. Elmar Brähler, Dorothee Alfermann, Jeannine Stiller, 140-161, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Swim, Janet K. 1994. Perceived versus meta-analytic effect sizes: an assessment of the accuracy of gender stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology 66(1):21-36.
Teubner, Ulrike. 2010. Beruf: Vom Frauenberuf zur Geschlechterkonstruktion im Berufssystem. In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 500–506, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Tonn, Julia Jane. 2016. Frauen in Führungspositionen. Ursachen der Unterpräsentanz weiblicher Führungskräfte in Unternehmen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Tracey, Paul und Nelson Phillips, Owen Javis. 2011. Bridging institutional entrepeneurship and the creation of new organizational forms: a multilevel model. Organization Science 22(1): 60-80.
Van den Bussche, Hendrik und Jana Jünger, Bernt-Peter Robra et al. 2013. Berufsvorstellungen, berufliche Lage und soziale Situation von Ärztinnen und Ärzte am Studienende und zu Weiterbildungsbeginn – erste Ergebnisse der KarMed-Studie. In Perspektiven junger Ärztinnen und Ärzte in der Patientenversorgung. Report Versorgungsforschung, Bd. 6, hrsg. Christoph Fuchs, Bärbel-Maria Kurth, Peter C. Scriba, 209-218, Köln: Deutscher Ärzteverlag.
Van den Bussche, Hendrik und C. Wonneberger, S. Birck et al. 2014. Die berufliche und private Situation von Ärztinnen und Ärzten zu Beginn der fachärztlichen Weiterbildung. Gesundheitswesen 76(2):e1–e6.
Van den Bussche, Hendrik und Stine Ziegler, Anja Rakebrandt et al. 2017. Die Resultate von sechs Jahren Weiterbildung für die hausärztliche Versorgung in Deutschland –Teil 1. Z Allg Med 92(7/8):314-319.
Van den Bussche, Hendrik und Stephanie Siegert, Sarah Nehls et al. 2018. Die Resultate von sechs Jahren Weiterbildung für die hausärztliche Versorgung in Deutschland –Teil 1. Z Allg Med 94(9):362-366.
Van den Bussche, Hendrik und Sigrid Boczor, Stephanie Siegert et al. 2019. Die Resultate von sechs Jahren Weiterbildung für die hausärztliche Versorgung in Deutschland – Ergebnisse der KarMed-Studie (Teil 2). Z Allg Med 95(1):9-13.
Vila-Henninger, Luis A. 2014. Toward defining the causal role of consciousness: Using models of memory and moral judgement from cognitive neuroscience to expand the sociological dual-process model. Journal for the Theory of Social Behaviour 45(2):238-260.
Von Alemann, Annette. 2017. ‚Scheinheiligkeit‘ von Organisationen: Paradoxien und Tabus. Das Beispiel der Vereinbarkeitsmaßnahmen und ihrer Nutzung. In Neo-Institutionalismus – Revisited. Bilanz und Weiterentwicklungen aus Sicht der Geschlechterforschung, hg. Maria Funder, 415-438, Baden-Baden: Nomos Verlag.
Wagner, Maria. 2010. Familie und Beruf: Geschlechtsspezifische und fachspezifische Unterschiede von Pädogog/innen und Mediziner/innen. In Transitionen – Übergänge vom Studium in den Beruf, Zur Verbindung von qualitativer und quantitativer Forschung, hrsg. Heide von Felden und Jürgen Schiener, 157-183, Wiesbaden: Springer VS.
Weik, Elke. 2011. Institutional entrepeneurship and agency. Journal for the Theory of Social Behaviour 41(4): 466-481.
Weingessel, B. und A. Scholler, J. Fischl, P.V. Vécsei-Marlovits. 2011. Geschlechtsspezifische Unterschiede bei OperateurInnen in der Versorgung der rhegmatogenen Ablatio retinae. Spektrum Augenheilkd 25(4):269–272.
Wengler, Annelene und Heike Trappe, Christian Schmitt. 2008. Partnerschaftliche Arbeitsteilung und Elternschaft. Analysen zur Aufteilung von Hausarbeit und Elternaufgaben auf Basis des Generations and Gender Survey. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Wetterer, Angelika. 2002. Arbeitsteilung und Geschlechterkonstruktion. „Gender at Work“ in theoretischer und historischer Perspektive. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
Wilkesmann, Maximiliane. 2009. Wissenstransfer im Krankenhaus. Institutionelle und strukturelle Voraussetzungen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Williams, John E. und Robert C. Satterwhite, Deborah L. Best. 1999. Pancultural gender stereotypes revisited: the five factor model. Sex Roles 40(7/8):513-526.
Wilz, Sylvia M. 2010. Organisation: Die Debatte um ‚Gendered Organizations‘. In Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hrsg. Ruth Becker und Beate Kortendiek, 513–519, 3. Aufl., Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Wilz, Sylvia M. 2013. Geschlechterdifferenzierung von und in Organisationen. In Geschlecht und Organisation, hrsg. Ursula Müller, Birgit Riegraf, Sylvia M. Wilz, 150-160, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Wilz, Sylvia M. 2015. Skizze zur praxistheoretischen Debatte um Organisation. In Zur Zukunft der Organisationsoziologie, hrsg. Maja Apelt und Uwe Wilkesmann, 253-270, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Woltersdorff, Volker. 2015. Normalitätsregime von Geschlecht und Sexualität im Kontext von Arbeit. In Des eigenen Glückes Schmied_in!? Geschlechterreflektierende Perspektiven auf berufliche Orientierungen und Lebensplanungen von Jugendlichen, hrsg. Christiane Micus-Loos und Melanie Plößer, 43-58, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Ziegler, Stine und Lea Krause-Solberg, Martin Scherer, Hendrik van den Bussche. 2017a. Arbeitszeitvorstellungen von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung: Entwicklungen über eine vierjährige Weiterbildungsdauer. Bundesgesundheitsblatt 60(10):1115–1123.
Ziegler, Stine und Thomas Zimmermann, Lea Krause-Solberg, Martin Scherer, Hendrik van den Bussche. 2017b. Ärzte und Ärztinnen in der fachärztlichen Weiterbildung – Eine Analyse der geschlechtsspezifischen Karriereperspektiven und deren Bedingungen. Journal for Medical Education 34(5):9-17.
Ziegler, Stine und Hendrik van den Bussche, Farina Römer, Lea Krause-Solberg, Martin Scherer. 2017c. Berufliche Präferenzen bezüglich Versorgungssektor und Position von Ärztinnen und Ärzten nach vierjähriger fachärztlicher Weiterbildung. Deutsche Medizinische Wochenschrift 142:e74-e82.